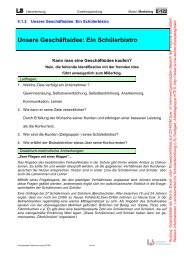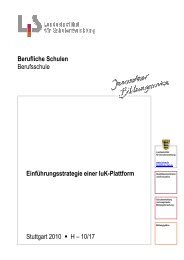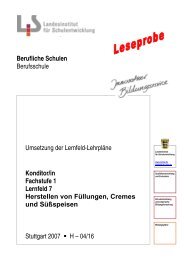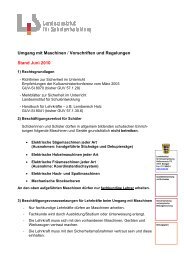Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Landesinstitut</strong> <strong>für</strong> Schulentwicklung<br />
Ich weiß freilich nicht, ob es besser werden wird,<br />
wenn es anders wird, ich weiß aber,<br />
dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll.<br />
Georg Christoph Lichtenberg<br />
1 Merkmale des kompetenzorientierten Unterrichts<br />
Der Kern des PISA-Schocks <strong>im</strong> Jahre 2000 bestand in der Erkenntnis, dass<br />
man gedacht hatte, die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler könnten die Aufgaben in<br />
den verschiedenen Bereichen lösen, <strong>und</strong> nun stellte sich heraus, dass viele es<br />
eben nicht konnten. Das gezeigte Niveau war enttäuschend <strong>und</strong> die Lehrkräfte<br />
mussten sich eingestehen, dass sie den tatsächlichen Leistungsstand der<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler falsch eingeschätzt hatten. Gr<strong>und</strong>sätzliche Zweifel<br />
an ihrer Beurteilungskompetenz entstanden. Spätestens seit den unbefriedigenden<br />
Resultaten der nationalen <strong>und</strong> internationalen Vergleichstests wird in<br />
der Öffentlichkeit intensiv darüber nachgedacht, warum viele Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler so wenig an Wissen, Fertigkeiten <strong>und</strong> Fähigkeiten mitbringen <strong>und</strong> warum<br />
die Lernergebnisse nach der Klassenarbeit weitgehend in Vergessenheit<br />
geraten, der Unterricht also anscheinend kaum eine nachhaltige Wirkung erzielt.<br />
Da überrascht es kaum, dass Gerhard Roth, der Präsident der Studienstiftung<br />
des deutschen Volkes <strong>und</strong> Direktor des Instituts <strong>für</strong> Hirnforschung an der<br />
Universität Bremen, in seinem neuesten Buch 1 darauf hinweist, dass bei Überprüfungen<br />
des Gelernten fünf Jahre nach Schulabschluss von den getesteten<br />
jungen Leuten kaum noch schulisches Wissen reaktiviert werden konnte.<br />
Aus diesem Problem speist sich eine Frustrationsquelle der Lehrkräfte <strong>und</strong><br />
zugleich stellt es auch eine ständige Herausforderung <strong>im</strong> Schulalltag dar. Der<br />
kompetenzorientierte Unterricht versucht da<strong>für</strong> einen Lösungsweg anzubieten.<br />
Gerhard Ziener 2 empfiehlt, vor der Planung einer neuen Unterrichtseinheit die<br />
Frage zu beantworten:<br />
Was sollen meine Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler durch die nächste Unterrichtseinheit<br />
lernen? Und <strong>für</strong> die Nachbereitung am Ende der Unterrichtseinheit<br />
schlägt er die Überlegung vor:<br />
Was können meine Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler jetzt, sodass ich darauf verlässlich<br />
zurückgreifen kann, <strong>und</strong> in welchem Grad?<br />
Mit diesen beiden gr<strong>und</strong>sätzlichen Fragen könnten vielleicht schon zwei<br />
Fehler vermieden werden, die relativ häufig zu beobachten sind: Einerseits<br />
werden Unterrichtseinheiten ohne genauere Vernetzung aneinandergereiht<br />
– die Leitlinie dabei ist ein Stoffplan, der akribisch abgehakt wird. Andererseits<br />
werden die einzelnen St<strong>und</strong>en mit unrealistisch vielen Zielen überfrachtet, was<br />
sich letzten Endes noch auf das Lernzielverfahren der siebziger <strong>und</strong> achtziger<br />
Jahre zurückführen lässt, als man davon ausging, die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
mit vielen gleichzeitigen Impulsen zum erfolgreichen Lernen st<strong>im</strong>ulieren zu<br />
können. Heute geht es dagegen weniger um Details, sondern die großen Linien<br />
stehen <strong>im</strong> Vordergr<strong>und</strong>. Und die individuellen Voraussetzungen des Lernens<br />
sollen stärker beachtet werden. Das Konzept des kompetenzorientierten Unterrichts<br />
versucht dabei zu berücksichtigen, dass Wissen nie von außen eingepflanzt<br />
werden kann, sondern von jedem Lernenden <strong>im</strong>mer wieder neu rekonstruiert<br />
werden muss. 3 Gerhard Roth begründet den alten pädagogischen<br />
Leitsatz, dass weniger mehr ist, mit der begrenzten Kapazität unseres Arbeits-<br />
1 Gerhard Roth: Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt. Stuttgart 2011.<br />
2 Gerhard Ziener: Bildungsstandards in der Praxis: Kompetenzorientiert unterrichten.<br />
Seelze-Velber 2009.<br />
3 Eckard Klieme: Leitideen der Bildungsreform <strong>und</strong> der Bildungsforschung. In Pädagogik 5 (2009).<br />
PISA-Schock<br />
Zwei gr<strong>und</strong>sätzliche Fragen<br />
Zwei Fehler<br />
7