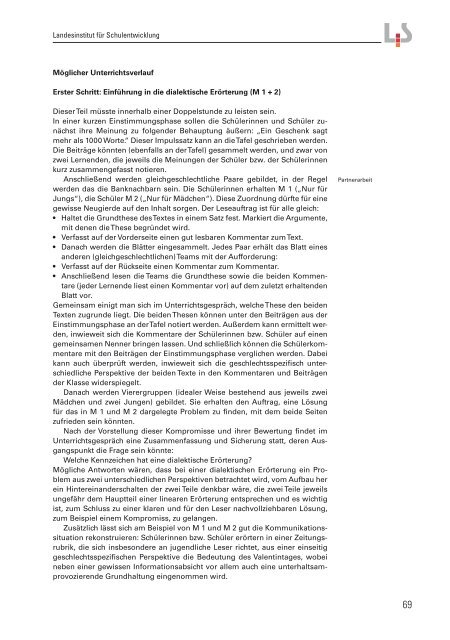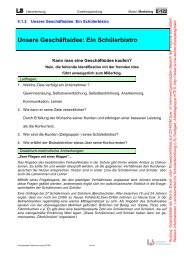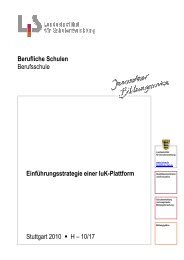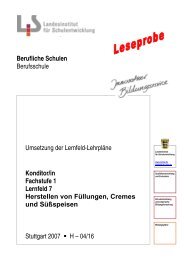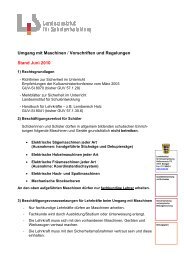Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Landesinstitut</strong> <strong>für</strong> Schulentwicklung<br />
Möglicher Unterrichtsverlauf<br />
Erster Schritt: Einführung in die dialektische Erörterung (M 1 + 2)<br />
Dieser Teil müsste innerhalb einer Doppelst<strong>und</strong>e zu leisten sein.<br />
In einer kurzen Einst<strong>im</strong>mungsphase sollen die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler zunächst<br />
ihre Meinung zu folgender Behauptung äußern: „Ein Geschenk sagt<br />
mehr als 1000 Worte.“ Dieser Impulssatz kann an die Tafel geschrieben werden.<br />
Die Beiträge könnten (ebenfalls an der Tafel) gesammelt werden, <strong>und</strong> zwar von<br />
zwei Lernenden, die jeweils die Meinungen der Schüler bzw. der Schülerinnen<br />
kurz zusammengefasst notieren.<br />
Anschließend werden gleichgeschlechtliche Paare gebildet, in der Regel<br />
werden das die Banknachbarn sein. Die Schülerinnen erhalten M 1 („Nur <strong>für</strong><br />
Jungs“), die Schüler M 2 („Nur <strong>für</strong> Mädchen“). Diese Zuordnung dürfte <strong>für</strong> eine<br />
gewisse Neugierde auf den Inhalt sorgen. Der Leseauftrag ist <strong>für</strong> alle gleich:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Haltet die Gr<strong>und</strong>these des Textes in einem Satz fest. Markiert die Argumente,<br />
mit denen die These begründet wird.<br />
Verfasst auf der Vorderseite einen gut lesbaren Kommentar zum Text.<br />
Danach werden die Blätter eingesammelt. Jedes Paar erhält das Blatt eines<br />
anderen (gleichgeschlechtlichen) Teams mit der Aufforderung:<br />
Verfasst auf der Rückseite einen Kommentar zum Kommentar.<br />
Anschließend lesen die Teams die Gr<strong>und</strong>these sowie die beiden Kommentare<br />
(jeder Lernende liest einen Kommentar vor) auf dem zuletzt erhaltenden<br />
Blatt vor.<br />
Gemeinsam einigt man sich <strong>im</strong> Unterrichtsgespräch, welche These den beiden<br />
Texten zugr<strong>und</strong>e liegt. Die beiden Thesen können unter den Beiträgen aus der<br />
Einst<strong>im</strong>mungsphase an der Tafel notiert werden. Außerdem kann ermittelt werden,<br />
inwieweit sich die Kommentare der Schülerinnen bzw. Schüler auf einen<br />
gemeinsamen Nenner bringen lassen. Und schließlich können die Schülerkommentare<br />
mit den Beiträgen der Einst<strong>im</strong>mungsphase verglichen werden. Dabei<br />
kann auch überprüft werden, inwieweit sich die geschlechtsspezifisch unterschiedliche<br />
Perspektive der beiden Texte in den Kommentaren <strong>und</strong> Beiträgen<br />
der Klasse widerspiegelt.<br />
Danach werden Vierergruppen (idealer Weise bestehend aus jeweils zwei<br />
Mädchen <strong>und</strong> zwei Jungen) gebildet. Sie erhalten den Auftrag, eine Lösung<br />
<strong>für</strong> das in M 1 <strong>und</strong> M 2 dargelegte Problem zu finden, mit dem beide Seiten<br />
zufrieden sein könnten.<br />
Nach der Vorstellung dieser Kompromisse <strong>und</strong> ihrer Bewertung findet <strong>im</strong><br />
Unterrichtsgespräch eine Zusammenfassung <strong>und</strong> Sicherung statt, deren Ausgangspunkt<br />
die Frage sein könnte:<br />
Welche Kennzeichen hat eine dialektische Erörterung?<br />
Mögliche Antworten wären, dass bei einer dialektischen Erörterung ein Problem<br />
aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird, vom Aufbau her<br />
ein Hintereinanderschalten der zwei Teile denkbar wäre, die zwei Teile jeweils<br />
ungefähr dem Hauptteil einer linearen Erörterung entsprechen <strong>und</strong> es wichtig<br />
ist, zum Schluss zu einer klaren <strong>und</strong> <strong>für</strong> den Leser nachvollziehbaren Lösung,<br />
zum Beispiel einem Kompromiss, zu gelangen.<br />
Zusätzlich lässt sich am Beispiel von M 1 <strong>und</strong> M 2 gut die Kommunikationssituation<br />
rekonstruieren: Schülerinnen bzw. Schüler erörtern in einer Zeitungsrubrik,<br />
die sich insbesondere an jugendliche Leser richtet, aus einer einseitig<br />
geschlechtsspezifischen Perspektive die Bedeutung des Valentintages, wobei<br />
neben einer gewissen Informationsabsicht vor allem auch eine unterhaltsamprovozierende<br />
Gr<strong>und</strong>haltung eingenommen wird.<br />
Partnerarbeit<br />
69