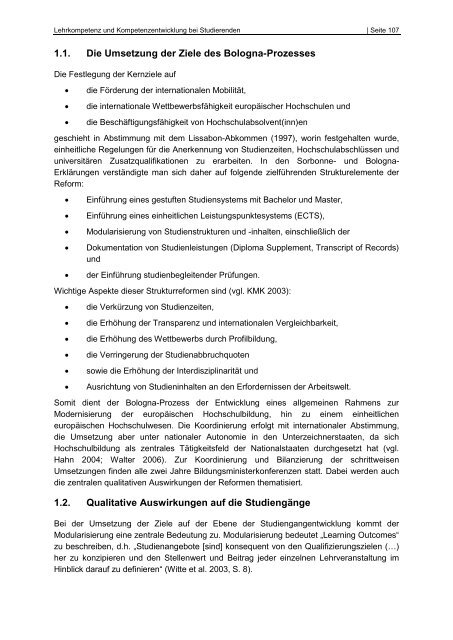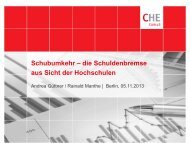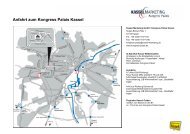Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Lehrkompetenz und Kompetenzentwicklung bei Studierenden | Seite 107<br />
1.1. Die Umsetzung <strong>der</strong> Ziele des <strong>Bologna</strong>-<strong>Prozess</strong>es<br />
Die Festlegung <strong>der</strong> Kernziele auf<br />
� die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> internationalen Mobilität,<br />
� die internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Hochschulen und<br />
� die Beschäftigungsfähigkeit von Hochschulabsolvent(inn)en<br />
geschieht in Abstimmung mit dem Lissabon-Abkommen (1997), worin festgehalten wurde,<br />
einheitliche Regelungen für die Anerkennung von Studienzeiten, Hochschulabschlüssen und<br />
universitären Zusatzqualifikationen zu erarbeiten. In den Sorbonne- und <strong>Bologna</strong>-<br />
Erklärungen verständigte man sich daher auf folgende zielführenden Strukturelemente <strong>der</strong><br />
Reform:<br />
� Einführung eines gestuften Studiensystems mit Bachelor und Master,<br />
� Einführung eines einheitlichen Leistungspunktesystems (ECTS),<br />
� Modularisierung von Studienstrukturen und -inhalten, einschließlich <strong>der</strong><br />
� Dokumentation von Studienleistungen (Diploma Supplement, Transcript of Records)<br />
und<br />
� <strong>der</strong> Einführung studienbegleiten<strong>der</strong> Prüfungen.<br />
Wichtige Aspekte dieser Strukturreformen sind (vgl. KMK 2003):<br />
� die Verkürzung von Studienzeiten,<br />
� die Erhöhung <strong>der</strong> Transparenz und internationalen Vergleichbarkeit,<br />
� die Erhöhung des Wettbewerbs durch Profilbildung,<br />
� die Verringerung <strong>der</strong> Studienabbruchquoten<br />
� sowie die Erhöhung <strong>der</strong> Interdisziplinarität und<br />
� Ausrichtung von Studieninhalten an den Erfor<strong>der</strong>nissen <strong>der</strong> Arbeitswelt.<br />
Somit dient <strong>der</strong> <strong>Bologna</strong>-<strong>Prozess</strong> <strong>der</strong> Entwicklung eines allgemeinen Rahmens zur<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> europäischen Hochschulbildung, hin zu einem einheitlichen<br />
europäischen Hochschulwesen. Die Koordinierung erfolgt mit internationaler Abstimmung,<br />
die Umsetzung aber unter nationaler Autonomie in den Unterzeichnerstaaten, da sich<br />
Hochschulbildung als zentrales Tätigkeitsfeld <strong>der</strong> Nationalstaaten durchgesetzt hat (vgl.<br />
Hahn 2004; Walter 2006). Zur Koordinierung und Bilanzierung <strong>der</strong> schrittweisen<br />
Umsetzungen finden alle zwei Jahre Bildungsministerkonferenzen statt. Dabei werden auch<br />
die zentralen qualitativen Auswirkungen <strong>der</strong> Reformen thematisiert.<br />
1.2. Qualitative Auswirkungen auf die Studiengänge<br />
Bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Ziele auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Studiengangentwicklung kommt <strong>der</strong><br />
Modularisierung eine zentrale Bedeutung zu. Modularisierung bedeutet „Learning Outcomes“<br />
zu beschreiben, d.h. „Studienangebote [sind] konsequent von den Qualifizierungszielen (…)<br />
her zu konzipieren und den Stellenwert und Beitrag je<strong>der</strong> einzelnen Lehrveranstaltung im<br />
Hinblick darauf zu definieren“ (Witte et al. 2003, S. 8).