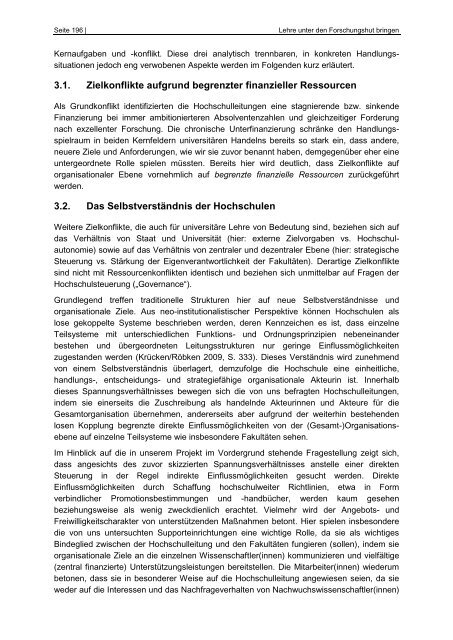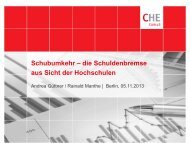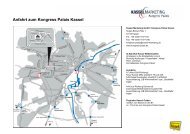Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seite 196 | Lehre unter den Forschungshut bringen<br />
Kernaufgaben und -konflikt. Diese drei analytisch trennbaren, in konkreten Handlungssituationen<br />
jedoch eng verwobenen Aspekte werden im Folgenden kurz erläutert.<br />
3.1. Zielkonflikte aufgrund begrenzter finanzieller Ressourcen<br />
Als Grundkonflikt identifizierten die Hochschulleitungen eine stagnierende bzw. sinkende<br />
Finanzierung bei immer ambitionierteren Absolventenzahlen und gleichzeitiger For<strong>der</strong>ung<br />
nach exzellenter Forschung. Die chronische Unterfinanzierung schränke den Handlungsspielraum<br />
in beiden Kernfel<strong>der</strong>n universitären Handelns bereits so stark ein, dass an<strong>der</strong>e,<br />
neuere Ziele und Anfor<strong>der</strong>ungen, wie wir sie zuvor benannt haben, demgegenüber eher eine<br />
untergeordnete Rolle spielen müssten. Bereits hier wird deutlich, dass Zielkonflikte auf<br />
organisationaler Ebene vornehmlich auf begrenzte finanzielle Ressourcen zurückgeführt<br />
werden.<br />
3.2. Das Selbstverständnis <strong>der</strong> Hochschulen<br />
Weitere Zielkonflikte, die auch für universitäre Lehre von Bedeutung sind, beziehen sich auf<br />
das Verhältnis von Staat und Universität (hier: externe Zielvorgaben vs. Hochschulautonomie)<br />
sowie auf das Verhältnis von zentraler und dezentraler Ebene (hier: strategische<br />
Steuerung vs. Stärkung <strong>der</strong> Eigenverantwortlichkeit <strong>der</strong> Fakultäten). <strong>Der</strong>artige Zielkonflikte<br />
sind nicht mit Ressourcenkonflikten identisch und beziehen sich unmittelbar auf Fragen <strong>der</strong><br />
Hochschulsteuerung („Governance“).<br />
Grundlegend treffen traditionelle Strukturen hier auf neue Selbstverständnisse und<br />
organisationale Ziele. Aus neo-institutionalistischer Perspektive können Hochschulen als<br />
lose gekoppelte Systeme beschrieben werden, <strong>der</strong>en Kennzeichen es ist, dass einzelne<br />
Teilsysteme mit unterschiedlichen Funktions- und Ordnungsprinzipien nebeneinan<strong>der</strong><br />
bestehen und übergeordneten Leitungsstrukturen nur geringe Einflussmöglichkeiten<br />
zugestanden werden (Krücken/Röbken 2009, S. 333). Dieses Verständnis wird zunehmend<br />
von einem Selbstverständnis überlagert, demzufolge die Hochschule eine einheitliche,<br />
handlungs-, entscheidungs- und strategiefähige organisationale Akteurin ist. Innerhalb<br />
dieses Spannungsverhältnisses bewegen sich die von uns befragten Hochschulleitungen,<br />
indem sie einerseits die Zuschreibung als handelnde Akteurinnen und Akteure für die<br />
Gesamtorganisation übernehmen, an<strong>der</strong>erseits aber aufgrund <strong>der</strong> weiterhin bestehenden<br />
losen Kopplung begrenzte direkte Einflussmöglichkeiten von <strong>der</strong> (Gesamt-)Organisationsebene<br />
auf einzelne Teilsysteme wie insbeson<strong>der</strong>e Fakultäten sehen.<br />
Im Hinblick auf die in unserem Projekt im Vor<strong>der</strong>grund stehende Fragestellung zeigt sich,<br />
dass angesichts des zuvor skizzierten Spannungsverhältnisses anstelle einer direkten<br />
Steuerung in <strong>der</strong> Regel indirekte Einflussmöglichkeiten gesucht werden. Direkte<br />
Einflussmöglichkeiten durch Schaffung hochschulweiter Richtlinien, etwa in Form<br />
verbindlicher Promotionsbestimmungen und -handbücher, werden kaum gesehen<br />
beziehungsweise als wenig zweckdienlich erachtet. Vielmehr wird <strong>der</strong> Angebots- und<br />
Freiwilligkeitscharakter von unterstützenden Maßnahmen betont. Hier spielen insbeson<strong>der</strong>e<br />
die von uns untersuchten Supporteinrichtungen eine wichtige Rolle, da sie als wichtiges<br />
Bindeglied zwischen <strong>der</strong> Hochschulleitung und den Fakultäten fungieren (sollen), indem sie<br />
organisationale Ziele an die einzelnen Wissenschaftler(innen) kommunizieren und vielfältige<br />
(zentral finanzierte) Unterstützungsleistungen bereitstellen. Die Mitarbeiter(innen) wie<strong>der</strong>um<br />
betonen, dass sie in beson<strong>der</strong>er Weise auf die Hochschulleitung angewiesen seien, da sie<br />
we<strong>der</strong> auf die Interessen und das Nachfrageverhalten von Nachwuchswissenschaftler(innen)