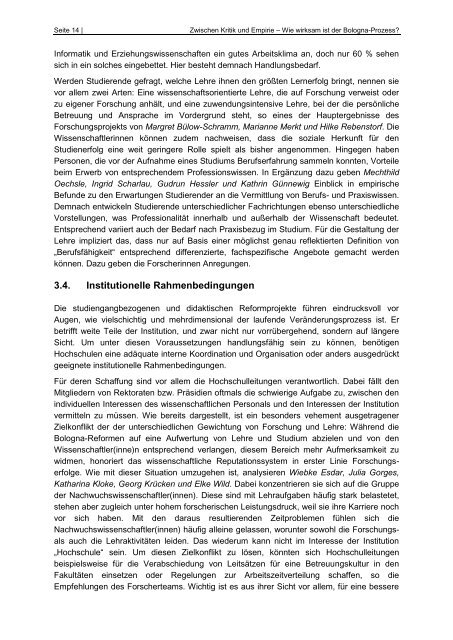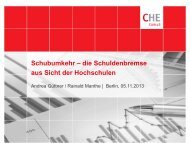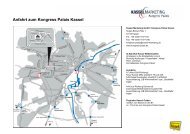Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 14 | Zwischen Kritik und Empirie – Wie wirksam ist <strong>der</strong> <strong>Bologna</strong>-<strong>Prozess</strong>?<br />
Informatik und Erziehungswissenschaften ein gutes Arbeitsklima an, doch nur 60 % sehen<br />
sich in ein solches eingebettet. Hier besteht demnach Handlungsbedarf.<br />
Werden Studierende gefragt, welche Lehre ihnen den größten Lernerfolg bringt, nennen sie<br />
vor allem zwei Arten: Eine wissenschaftsorientierte Lehre, die auf Forschung verweist o<strong>der</strong><br />
zu eigener Forschung anhält, und eine zuwendungsintensive Lehre, bei <strong>der</strong> die persönliche<br />
Betreuung und Ansprache im Vor<strong>der</strong>grund steht, so eines <strong>der</strong> Hauptergebnisse des<br />
Forschungsprojekts von Margret Bülow-Schramm, Marianne Merkt und Hilke Rebenstorf. Die<br />
Wissenschaftlerinnen können zudem nachweisen, dass die soziale Herkunft für den<br />
Studienerfolg eine weit geringere Rolle spielt als bisher angenommen. Hingegen haben<br />
Personen, die vor <strong>der</strong> Aufnahme eines Studiums Berufserfahrung sammeln konnten, Vorteile<br />
beim Erwerb von entsprechendem Professionswissen. In Ergänzung dazu geben Mechthild<br />
Oechsle, Ingrid Scharlau, Gudrun Hessler und Kathrin Günnewig Einblick in empirische<br />
Befunde zu den Erwartungen Studieren<strong>der</strong> an die Vermittlung von Berufs- und Praxiswissen.<br />
Demnach entwickeln Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen ebenso unterschiedliche<br />
Vorstellungen, was Professionalität innerhalb und außerhalb <strong>der</strong> Wissenschaft bedeutet.<br />
Entsprechend variiert auch <strong>der</strong> Bedarf nach Praxisbezug im Studium. Für die Gestaltung <strong>der</strong><br />
Lehre impliziert das, dass nur auf Basis einer möglichst genau reflektierten Definition von<br />
„Berufsfähigkeit“ entsprechend differenzierte, fachspezifische Angebote gemacht werden<br />
können. Dazu geben die Forscherinnen Anregungen.<br />
3.4. Institutionelle Rahmenbedingungen<br />
Die studiengangbezogenen und didaktischen Reformprojekte führen eindrucksvoll vor<br />
Augen, wie vielschichtig und mehrdimensional <strong>der</strong> laufende Verän<strong>der</strong>ungsprozess ist. Er<br />
betrifft weite Teile <strong>der</strong> Institution, und zwar nicht nur vorrübergehend, son<strong>der</strong>n auf längere<br />
<strong>Sicht</strong>. Um unter diesen Vor<strong>aus</strong>setzungen handlungsfähig sein zu können, benötigen<br />
Hochschulen eine adäquate interne Koordination und Organisation o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>s <strong>aus</strong>gedrückt<br />
geeignete institutionelle Rahmenbedingungen.<br />
Für <strong>der</strong>en Schaffung sind vor allem die Hochschulleitungen verantwortlich. Dabei fällt den<br />
Mitglie<strong>der</strong>n von Rektoraten bzw. Präsidien oftmals die schwierige Aufgabe zu, zwischen den<br />
individuellen Interessen des wissenschaftlichen Personals und den Interessen <strong>der</strong> Institution<br />
vermitteln zu müssen. Wie bereits dargestellt, ist ein beson<strong>der</strong>s vehement <strong>aus</strong>getragener<br />
Zielkonflikt <strong>der</strong> <strong>der</strong> unterschiedlichen Gewichtung von Forschung und Lehre: Während die<br />
<strong>Bologna</strong>-Reformen auf eine Aufwertung von Lehre und Studium abzielen und von den<br />
Wissenschaftler(inne)n entsprechend verlangen, diesem Bereich mehr Aufmerksamkeit zu<br />
widmen, honoriert das wissenschaftliche Reputationssystem in erster Linie Forschungserfolge.<br />
Wie mit dieser Situation umzugehen ist, analysieren Wiebke Esdar, Julia Gorges,<br />
Katharina Kloke, Georg Krücken und Elke Wild. Dabei konzentrieren sie sich auf die Gruppe<br />
<strong>der</strong> Nachwuchswissenschaftler(innen). Diese sind mit Lehraufgaben häufig stark belastetet,<br />
stehen aber zugleich unter hohem forscherischen Leistungsdruck, weil sie ihre Karriere noch<br />
vor sich haben. Mit den dar<strong>aus</strong> resultierenden Zeitproblemen fühlen sich die<br />
Nachwuchswissenschaftler(innen) häufig alleine gelassen, worunter sowohl die Forschungs-<br />
als auch die Lehraktivitäten leiden. Das wie<strong>der</strong>um kann nicht im Interesse <strong>der</strong> Institution<br />
„Hochschule“ sein. Um diesen Zielkonflikt zu lösen, könnten sich Hochschulleitungen<br />
beispielsweise für die Verabschiedung von Leitsätzen für eine Betreuungskultur in den<br />
Fakultäten einsetzen o<strong>der</strong> Regelungen zur Arbeitszeitverteilung schaffen, so die<br />
Empfehlungen des Forscherteams. Wichtig ist es <strong>aus</strong> ihrer <strong>Sicht</strong> vor allem, für eine bessere