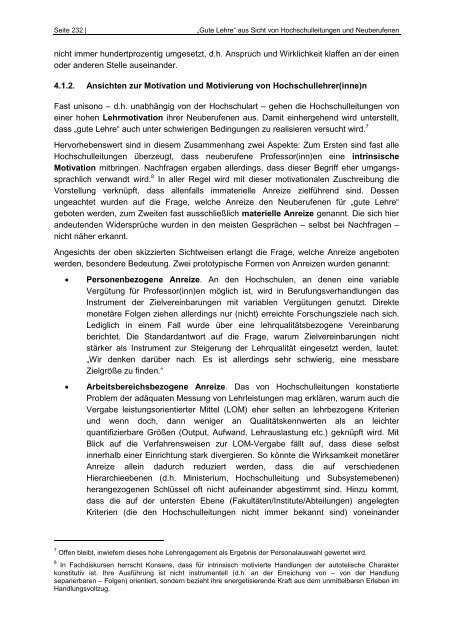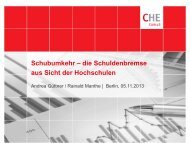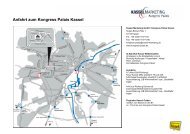Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 232 | „Gute Lehre“ <strong>aus</strong> <strong>Sicht</strong> von Hochschulleitungen und Neuberufenen<br />
nicht immer hun<strong>der</strong>tprozentig umgesetzt, d.h. Anspruch und Wirklichkeit klaffen an <strong>der</strong> einen<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Stelle <strong>aus</strong>einan<strong>der</strong>.<br />
4.1.2. Ansichten zur Motivation und Motivierung von Hochschullehrer(inne)n<br />
Fast unisono – d.h. unabhängig von <strong>der</strong> Hochschulart – gehen die Hochschulleitungen von<br />
einer hohen Lehrmotivation ihrer Neuberufenen <strong>aus</strong>. Damit einhergehend wird unterstellt,<br />
dass „gute Lehre“ auch unter schwierigen Bedingungen zu realisieren versucht wird. 7<br />
Hervorhebenswert sind in diesem Zusammenhang zwei Aspekte: Zum Ersten sind fast alle<br />
Hochschulleitungen überzeugt, dass neuberufene Professor(inn)en eine intrinsische<br />
Motivation mitbringen. Nachfragen ergaben allerdings, dass dieser Begriff eher umgangssprachlich<br />
verwandt wird. 8 In aller Regel wird mit dieser motivationalen Zuschreibung die<br />
Vorstellung verknüpft, dass allenfalls immaterielle Anreize zielführend sind. Dessen<br />
ungeachtet wurden auf die Frage, welche Anreize den Neuberufenen für „gute Lehre“<br />
geboten werden, zum Zweiten fast <strong>aus</strong>schließlich materielle Anreize genannt. Die sich hier<br />
andeutenden Wi<strong>der</strong>sprüche wurden in den meisten Gesprächen – selbst bei Nachfragen –<br />
nicht näher erkannt.<br />
Angesichts <strong>der</strong> oben skizzierten <strong>Sicht</strong>weisen erlangt die Frage, welche Anreize angeboten<br />
werden, beson<strong>der</strong>e Bedeutung. Zwei prototypische Formen von Anreizen wurden genannt:<br />
� Personenbezogene Anreize. An den Hochschulen, an denen eine variable<br />
Vergütung für Professor(inn)en möglich ist, wird in Berufungsverhandlungen das<br />
Instrument <strong>der</strong> Zielvereinbarungen mit variablen Vergütungen genutzt. Direkte<br />
monetäre Folgen ziehen allerdings nur (nicht) erreichte Forschungsziele nach sich.<br />
Lediglich in einem Fall wurde über eine lehrqualitätsbezogene Vereinbarung<br />
berichtet. Die Standardantwort auf die Frage, warum Zielvereinbarungen nicht<br />
stärker als Instrument zur Steigerung <strong>der</strong> Lehrqualität eingesetzt werden, lautet:<br />
„Wir denken darüber nach. Es ist allerdings sehr schwierig, eine messbare<br />
Zielgröße zu finden.“<br />
� Arbeitsbereichsbezogene Anreize. Das von Hochschulleitungen konstatierte<br />
Problem <strong>der</strong> adäquaten Messung von Lehrleistungen mag erklären, warum auch die<br />
Vergabe leistungsorientierter Mittel (LOM) eher selten an lehrbezogene Kriterien<br />
und wenn doch, dann weniger an Qualitätskennwerten als an leichter<br />
quantifizierbare Größen (Output, Aufwand, Lehr<strong>aus</strong>lastung etc.) geknüpft wird. Mit<br />
Blick auf die Verfahrensweisen zur LOM-Vergabe fällt auf, dass diese selbst<br />
innerhalb einer Einrichtung stark divergieren. So könnte die Wirksamkeit monetärer<br />
Anreize allein dadurch reduziert werden, dass die auf verschiedenen<br />
Hierarchieebenen (d.h. Ministerium, Hochschulleitung und Subsystemebenen)<br />
herangezogenen Schlüssel oft nicht aufeinan<strong>der</strong> abgestimmt sind. Hinzu kommt,<br />
dass die auf <strong>der</strong> untersten Ebene (Fakultäten/Institute/Abteilungen) angelegten<br />
Kriterien (die den Hochschulleitungen nicht immer bekannt sind) voneinan<strong>der</strong><br />
7 Offen bleibt, inwiefern dieses hohe Lehrengagement als Ergebnis <strong>der</strong> Personal<strong>aus</strong>wahl gewertet wird.<br />
8 In Fachdiskursen herrscht Konsens, dass für intrinsisch motivierte Handlungen <strong>der</strong> autotelische Charakter<br />
konstitutiv ist. Ihre Ausführung ist nicht instrumentell (d.h. an <strong>der</strong> Erreichung von – von <strong>der</strong> Handlung<br />
separierbaren – Folgen) orientiert, son<strong>der</strong>n bezieht ihre energetisierende Kraft <strong>aus</strong> dem unmittelbaren Erleben im<br />
Handlungsvollzug.