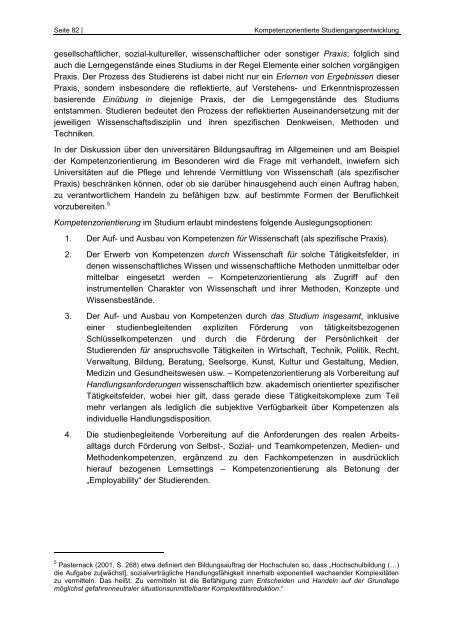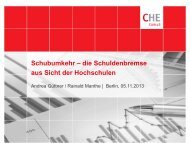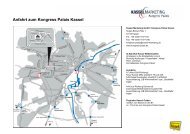Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seite 82 | Kompetenzorientierte Studiengangsentwicklung<br />
gesellschaftlicher, sozial-kultureller, wissenschaftlicher o<strong>der</strong> sonstiger Praxis; folglich sind<br />
auch die Lerngegenstände eines Studiums in <strong>der</strong> Regel Elemente einer solchen vorgängigen<br />
Praxis. <strong>Der</strong> <strong>Prozess</strong> des Studierens ist dabei nicht nur ein Erlernen von Ergebnissen dieser<br />
Praxis, son<strong>der</strong>n insbeson<strong>der</strong>e die reflektierte, auf Verstehens- und Erkenntnisprozessen<br />
basierende Einübung in diejenige Praxis, <strong>der</strong> die Lerngegenstände des Studiums<br />
entstammen. Studieren bedeutet den <strong>Prozess</strong> <strong>der</strong> reflektierten Auseinan<strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong><br />
jeweiligen Wissenschaftsdisziplin und ihren spezifischen Denkweisen, Methoden und<br />
Techniken.<br />
In <strong>der</strong> Diskussion über den universitären Bildungsauftrag im Allgemeinen und am Beispiel<br />
<strong>der</strong> Kompetenzorientierung im Beson<strong>der</strong>en wird die Frage mit verhandelt, inwiefern sich<br />
Universitäten auf die Pflege und lehrende Vermittlung von Wissenschaft (als spezifischer<br />
Praxis) beschränken können, o<strong>der</strong> ob sie darüber hin<strong>aus</strong>gehend auch einen Auftrag haben,<br />
zu verantwortlichem Handeln zu befähigen bzw. auf bestimmte Formen <strong>der</strong> Beruflichkeit<br />
vorzubereiten. 5<br />
Kompetenzorientierung im Studium erlaubt mindestens folgende Auslegungsoptionen:<br />
1. <strong>Der</strong> Auf- und Ausbau von Kompetenzen für Wissenschaft (als spezifische Praxis).<br />
2. <strong>Der</strong> Erwerb von Kompetenzen durch Wissenschaft für solche Tätigkeitsfel<strong>der</strong>, in<br />
denen wissenschaftliches Wissen und wissenschaftliche Methoden unmittelbar o<strong>der</strong><br />
mittelbar eingesetzt werden – Kompetenzorientierung als Zugriff auf den<br />
instrumentellen Charakter von Wissenschaft und ihrer Methoden, Konzepte und<br />
Wissensbestände.<br />
3. <strong>Der</strong> Auf- und Ausbau von Kompetenzen durch das Studium insgesamt, inklusive<br />
einer studienbegleitenden expliziten För<strong>der</strong>ung von tätigkeitsbezogenen<br />
Schlüsselkompetenzen und durch die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Persönlichkeit <strong>der</strong><br />
Studierenden für anspruchsvolle Tätigkeiten in Wirtschaft, Technik, Politik, Recht,<br />
Verwaltung, Bildung, Beratung, Seelsorge, Kunst, Kultur und Gestaltung, Medien,<br />
Medizin und Gesundheitswesen usw. – Kompetenzorientierung als Vorbereitung auf<br />
Handlungsanfor<strong>der</strong>ungen wissenschaftlich bzw. akademisch orientierter spezifischer<br />
Tätigkeitsfel<strong>der</strong>, wobei hier gilt, dass gerade diese Tätigkeitskomplexe zum Teil<br />
mehr verlangen als lediglich die subjektive Verfügbarkeit über Kompetenzen als<br />
individuelle Handlungsdisposition.<br />
4. Die studienbegleitende Vorbereitung auf die Anfor<strong>der</strong>ungen des realen Arbeitsalltags<br />
durch För<strong>der</strong>ung von Selbst-, Sozial- und Teamkompetenzen, Medien- und<br />
Methodenkompetenzen, ergänzend zu den Fachkompetenzen in <strong>aus</strong>drücklich<br />
hierauf bezogenen Lernsettings – Kompetenzorientierung als Betonung <strong>der</strong><br />
„Employability“ <strong>der</strong> Studierenden.<br />
5 Pasternack (2001, S. 268) etwa definiert den Bildungsauftrag <strong>der</strong> Hochschulen so, dass „Hochschulbildung (…)<br />
die Aufgabe zu[wächst], sozialverträgliche Handlungsfähigkeit innerhalb exponentiell wachsen<strong>der</strong> Komplexitäten<br />
zu vermitteln. Das heißt: Zu vermitteln ist die Befähigung zum Entscheiden und Handeln auf <strong>der</strong> Grundlage<br />
möglichst gefahrenneutraler situationsunmittelbarer Komplexitätsreduktion.“