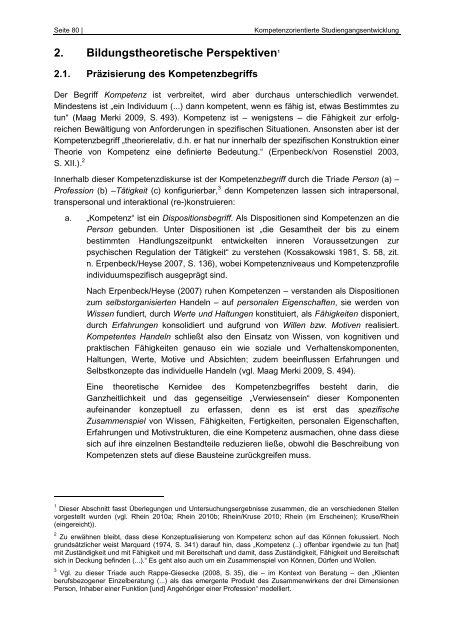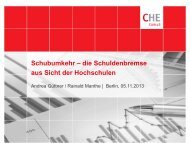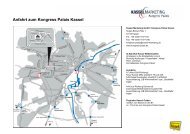Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 80 | Kompetenzorientierte Studiengangsentwicklung<br />
2. Bildungstheoretische Perspektiven 1<br />
2.1. Präzisierung des Kompetenzbegriffs<br />
<strong>Der</strong> Begriff Kompetenz ist verbreitet, wird aber durch<strong>aus</strong> unterschiedlich verwendet.<br />
Mindestens ist „ein Individuum (...) dann kompetent, wenn es fähig ist, etwas Bestimmtes zu<br />
tun“ (Maag Merki 2009, S. 493). Kompetenz ist – wenigstens – die Fähigkeit zur erfolgreichen<br />
Bewältigung von Anfor<strong>der</strong>ungen in spezifischen Situationen. Ansonsten aber ist <strong>der</strong><br />
Kompetenzbegriff „theorierelativ, d.h. er hat nur innerhalb <strong>der</strong> spezifischen Konstruktion einer<br />
Theorie von Kompetenz eine definierte Bedeutung.“ (Erpenbeck/von Rosenstiel 2003,<br />
S. XII.). 2<br />
Innerhalb dieser Kompetenzdiskurse ist <strong>der</strong> Kompetenzbegriff durch die Triade Person (a) –<br />
Profession (b) –Tätigkeit (c) konfigurierbar, 3 denn Kompetenzen lassen sich intrapersonal,<br />
transpersonal und interaktional (re-)konstruieren:<br />
a. „Kompetenz“ ist ein Dispositionsbegriff. Als Dispositionen sind Kompetenzen an die<br />
Person gebunden. Unter Dispositionen ist „die Gesamtheit <strong>der</strong> bis zu einem<br />
bestimmten Handlungszeitpunkt entwickelten inneren Vor<strong>aus</strong>setzungen zur<br />
psychischen Regulation <strong>der</strong> Tätigkeit“ zu verstehen (Kossakowski 1981, S. 58, zit.<br />
n. Erpenbeck/Heyse 2007, S. 136), wobei Kompetenznive<strong>aus</strong> und Kompetenzprofile<br />
individuumspezifisch <strong>aus</strong>geprägt sind.<br />
Nach Erpenbeck/Heyse (2007) ruhen Kompetenzen – verstanden als Dispositionen<br />
zum selbstorganisierten Handeln – auf personalen Eigenschaften, sie werden von<br />
Wissen fundiert, durch Werte und Haltungen konstituiert, als Fähigkeiten disponiert,<br />
durch Erfahrungen konsolidiert und aufgrund von Willen bzw. Motiven realisiert.<br />
Kompetentes Handeln schließt also den Einsatz von Wissen, von kognitiven und<br />
praktischen Fähigkeiten gen<strong>aus</strong>o ein wie soziale und Verhaltenskomponenten,<br />
Haltungen, Werte, Motive und Absichten; zudem beeinflussen Erfahrungen und<br />
Selbstkonzepte das individuelle Handeln (vgl. Maag Merki 2009, S. 494).<br />
Eine theoretische Kernidee des Kompetenzbegriffes besteht darin, die<br />
Ganzheitlichkeit und das gegenseitige „Verwiesensein“ dieser Komponenten<br />
aufeinan<strong>der</strong> konzeptuell zu erfassen, denn es ist erst das spezifische<br />
Zusammenspiel von Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, personalen Eigenschaften,<br />
Erfahrungen und Motivstrukturen, die eine Kompetenz <strong>aus</strong>machen, ohne dass diese<br />
sich auf ihre einzelnen Bestandteile reduzieren ließe, obwohl die Beschreibung von<br />
Kompetenzen stets auf diese B<strong>aus</strong>teine zurückgreifen muss.<br />
1 Dieser Abschnitt fasst Überlegungen und Untersuchungsergebnisse zusammen, die an verschiedenen Stellen<br />
vorgestellt wurden (vgl. Rhein 2010a; Rhein 2010b; Rhein/Kruse 2010; Rhein (im Erscheinen); Kruse/Rhein<br />
(eingereicht)).<br />
2 Zu erwähnen bleibt, dass diese Konzeptualisierung von Kompetenz schon auf das Können fokussiert. Noch<br />
grundsätzlicher weist Marquard (1974, S. 341) darauf hin, dass „Kompetenz (..) offenbar irgendwie zu tun [hat]<br />
mit Zuständigkeit und mit Fähigkeit und mit Bereitschaft und damit, dass Zuständigkeit, Fähigkeit und Bereitschaft<br />
sich in Deckung befinden (...).“ Es geht also auch um ein Zusammenspiel von Können, Dürfen und Wollen.<br />
3 Vgl. zu dieser Triade auch Rappe-Giesecke (2008, S. 35), die – im Kontext von Beratung – den „Klienten<br />
berufsbezogener Einzelberatung (...) als das emergente Produkt des Zusammenwirkens <strong>der</strong> drei Dimensionen<br />
Person, Inhaber einer Funktion [und] Angehöriger einer Profession“ modelliert.