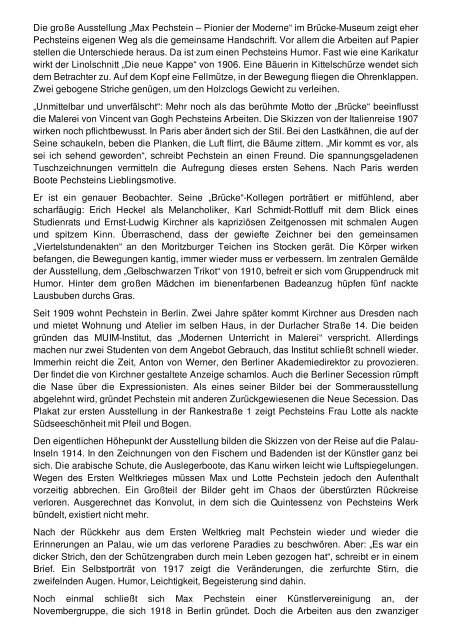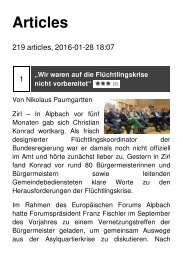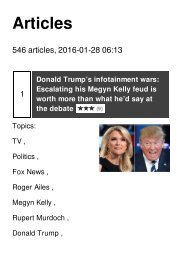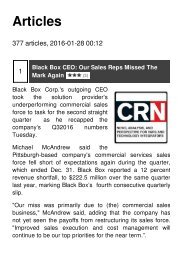Table of Contents Announcement Articles Table of Contents 1 6 29
deutschland_mix_de
deutschland_mix_de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die große Ausstellung „Max Pechstein – Pionier der Moderne“ im Brücke-Museum zeigt eher<br />
Pechsteins eigenen Weg als die gemeinsame Handschrift. Vor allem die Arbeiten auf Papier<br />
stellen die Unterschiede heraus. Da ist zum einen Pechsteins Humor. Fast wie eine Karikatur<br />
wirkt der Linolschnitt „Die neue Kappe“ von 1906. Eine Bäuerin in Kittelschürze wendet sich<br />
dem Betrachter zu. Auf dem Kopf eine Fellmütze, in der Bewegung fliegen die Ohrenklappen.<br />
Zwei gebogene Striche genügen, um den Holzclogs Gewicht zu verleihen.<br />
„Unmittelbar und unverfälscht“: Mehr noch als das berühmte Motto der „Brücke“ beeinflusst<br />
die Malerei von Vincent van Gogh Pechsteins Arbeiten. Die Skizzen von der Italienreise 1907<br />
wirken noch pflichtbewusst. In Paris aber ändert sich der Stil. Bei den Lastkähnen, die auf der<br />
Seine schaukeln, beben die Planken, die Luft flirrt, die Bäume zittern. „Mir kommt es vor, als<br />
sei ich sehend geworden“, schreibt Pechstein an einen Freund. Die spannungsgeladenen<br />
Tuschzeichnungen vermitteln die Aufregung dieses ersten Sehens. Nach Paris werden<br />
Boote Pechsteins Lieblingsmotive.<br />
Er ist ein genauer Beobachter. Seine „Brücke“-Kollegen porträtiert er mitfühlend, aber<br />
scharfäugig: Erich Heckel als Melancholiker, Karl Schmidt-Rottluff mit dem Blick eines<br />
Studienrats und Ernst-Ludwig Kirchner als kapriziösen Zeitgenossen mit schmalen Augen<br />
und spitzem Kinn. Überraschend, dass der gewiefte Zeichner bei den gemeinsamen<br />
„Viertelstundenakten“ an den Moritzburger Teichen ins Stocken gerät. Die Körper wirken<br />
befangen, die Bewegungen kantig, immer wieder muss er verbessern. Im zentralen Gemälde<br />
der Ausstellung, dem „Gelbschwarzen Trikot“ von 1910, befreit er sich vom Gruppendruck mit<br />
Humor. Hinter dem großen Mädchen im bienenfarbenen Badeanzug hüpfen fünf nackte<br />
Lausbuben durchs Gras.<br />
Seit 1909 wohnt Pechstein in Berlin. Zwei Jahre später kommt Kirchner aus Dresden nach<br />
und mietet Wohnung und Atelier im selben Haus, in der Durlacher Straße 14. Die beiden<br />
gründen das MUIM-Institut, das „Modernen Unterricht in Malerei“ verspricht. Allerdings<br />
machen nur zwei Studenten von dem Angebot Gebrauch, das Institut schließt schnell wieder.<br />
Immerhin reicht die Zeit, Anton von Werner, den Berliner Akademiedirektor zu provozieren.<br />
Der findet die von Kirchner gestaltete Anzeige schamlos. Auch die Berliner Secession rümpft<br />
die Nase über die Expressionisten. Als eines seiner Bilder bei der Sommerausstellung<br />
abgelehnt wird, gründet Pechstein mit anderen Zurückgewiesenen die Neue Secession. Das<br />
Plakat zur ersten Ausstellung in der Rankestraße 1 zeigt Pechsteins Frau Lotte als nackte<br />
Südseeschönheit mit Pfeil und Bogen.<br />
Den eigentlichen Höhepunkt der Ausstellung bilden die Skizzen von der Reise auf die Palau-<br />
Inseln 1914. In den Zeichnungen von den Fischern und Badenden ist der Künstler ganz bei<br />
sich. Die arabische Schute, die Auslegerboote, das Kanu wirken leicht wie Luftspiegelungen.<br />
Wegen des Ersten Weltkrieges müssen Max und Lotte Pechstein jedoch den Aufenthalt<br />
vorzeitig abbrechen. Ein Großteil der Bilder geht im Chaos der überstürzten Rückreise<br />
verloren. Ausgerechnet das Konvolut, in dem sich die Quintessenz von Pechsteins Werk<br />
bündelt, existiert nicht mehr.<br />
Nach der Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg malt Pechstein wieder und wieder die<br />
Erinnerungen an Palau, wie um das verlorene Paradies zu beschwören. Aber: „Es war ein<br />
dicker Strich, den der Schützengraben durch mein Leben gezogen hat“, schreibt er in einem<br />
Brief. Ein Selbstporträt von 1917 zeigt die Veränderungen, die zerfurchte Stirn, die<br />
zweifelnden Augen. Humor, Leichtigkeit, Begeisterung sind dahin.<br />
Noch einmal schließt sich Max Pechstein einer Künstlervereinigung an, der<br />
Novembergruppe, die sich 1918 in Berlin gründet. Doch die Arbeiten aus den zwanziger