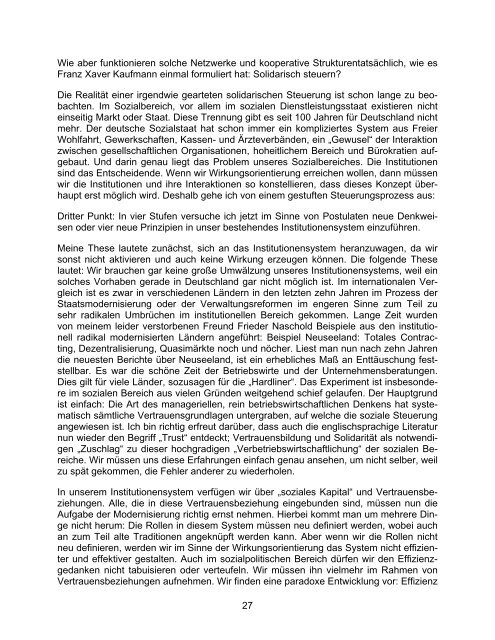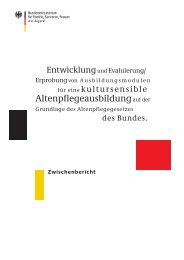Dr. Jan Schröder - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen ...
Dr. Jan Schröder - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen ...
Dr. Jan Schröder - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wie aber funktionieren solche Netzwerke und kooperative Strukturentatsächlich, wie es<br />
Franz Xaver Kaufmann einmal formuliert hat: Solidarisch steuern?<br />
Die Realität einer irgendwie gearteten solidarischen Steuerung ist schon lange zu beobachten.<br />
Im Sozialbereich, vor allem im sozialen Dienstleistungsstaat existieren nicht<br />
einseitig Markt oder Staat. Diese Trennung gibt es seit 100 Jahren <strong>für</strong> Deutschland nicht<br />
mehr. Der deutsche Sozialstaat hat schon immer ein kompliziertes System aus Freier<br />
Wohlfahrt, Gewerkschaften, Kassen- und Ärzteverbänden, ein „Gewusel“ der Interaktion<br />
zwischen gesellschaftlichen Organisationen, hoheitlichem Bereich und Bürokratien aufgebaut.<br />
Und darin genau liegt das Problem unseres Sozialbereiches. Die Institutionen<br />
sind das Entscheidende. Wenn wir Wirkungsorientierung erreichen wollen, dann müssen<br />
wir die Institutionen und ihre Interaktionen so konstellieren, dass dieses Konzept überhaupt<br />
erst möglich wird. Deshalb gehe ich von einem gestuften Steuerungsprozess aus:<br />
<strong>Dr</strong>itter Punkt: In vier Stufen versuche ich jetzt im Sinne von Postulaten neue Denkweisen<br />
oder vier neue Prinzipien in unser bestehendes Institutionensystem einzuführen.<br />
Meine These lautete zunächst, sich an das Institutionensystem heranzuwagen, da wir<br />
sonst nicht aktivieren und auch keine Wirkung erzeugen können. Die folgende These<br />
lautet: Wir brauchen gar keine große Umwälzung unseres Institutionensystems, weil ein<br />
solches Vorhaben gerade in Deutschland gar nicht möglich ist. Im internationalen Vergleich<br />
ist es zwar in verschiedenen Ländern in den letzten zehn Jahren im Prozess der<br />
Staatsmodernisierung oder der Verwaltungsreformen im engeren Sinne zum Teil zu<br />
sehr radikalen Umbrüchen im institutionellen Bereich gekommen. Lange Zeit wurden<br />
von meinem leider verstorbenen Freund Frieder Naschold Beispiele aus den institutionell<br />
radikal modernisierten Ländern angeführt: Beispiel Neuseeland: Totales Contracting,<br />
Dezentralisierung, Quasimärkte noch und nöcher. Liest man nun nach zehn Jahren<br />
die neuesten Berichte über Neuseeland, ist ein erhebliches Maß an Enttäuschung feststellbar.<br />
Es war die schöne Zeit der Betriebswirte und der Unternehmensberatungen.<br />
Dies gilt <strong>für</strong> viele Länder, sozusagen <strong>für</strong> die „Hardliner“. Das Experiment ist insbesondere<br />
im sozialen Bereich aus vielen Gründen weitgehend schief gelaufen. Der Hauptgrund<br />
ist einfach: Die Art des manageriellen, rein betriebswirtschaftlichen Denkens hat systematisch<br />
sämtliche Vertrauensgrundlagen untergraben, auf welche die soziale Steuerung<br />
angewiesen ist. Ich bin richtig erfreut darüber, dass auch die englischsprachige Literatur<br />
nun wieder den Begriff „Trust“ entdeckt; Vertrauensbildung und Solidarität als notwendigen<br />
„Zuschlag“ zu dieser hochgradigen „Verbetriebswirtschaftlichung“ der sozialen Bereiche.<br />
Wir müssen uns diese Erfahrungen einfach genau ansehen, um nicht selber, weil<br />
zu spät gekommen, die Fehler anderer zu wiederholen.<br />
In unserem Institutionensystem verfügen wir über „soziales Kapital“ und Vertrauensbeziehungen.<br />
Alle, die in diese Vertrauensbeziehung eingebunden sind, müssen nun die<br />
Aufgabe der Modernisierung richtig ernst nehmen. Hierbei kommt man um mehrere Dinge<br />
nicht herum: Die Rollen in diesem System müssen neu definiert werden, wobei auch<br />
an zum Teil alte Traditionen angeknüpft werden kann. Aber wenn wir die Rollen nicht<br />
neu definieren, werden wir im Sinne der Wirkungsorientierung das System nicht effizienter<br />
und effektiver gestalten. Auch im sozialpolitischen Bereich dürfen wir den Effizienzgedanken<br />
nicht tabuisieren oder verteufeln. Wir müssen ihn vielmehr im Rahmen von<br />
Vertrauensbeziehungen aufnehmen. Wir finden eine paradoxe Entwicklung vor: Effizienz<br />
27