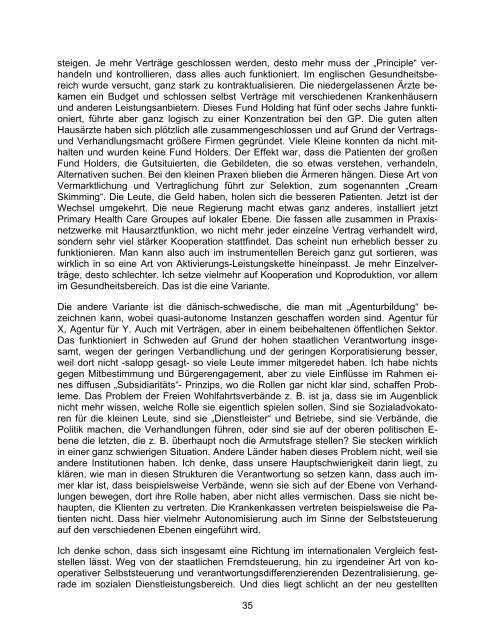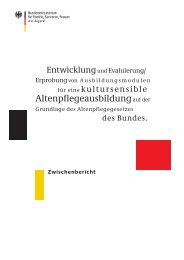Dr. Jan Schröder - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen ...
Dr. Jan Schröder - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen ...
Dr. Jan Schröder - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
steigen. Je mehr Verträge geschlossen werden, desto mehr muss der „Principle“ verhandeln<br />
und kontrollieren, dass alles auch funktioniert. Im englischen Gesundheitsbereich<br />
wurde versucht, ganz stark zu kontraktualisieren. Die niedergelassenen Ärzte bekamen<br />
ein Budget und schlossen selbst Verträge mit verschiedenen Krankenhäusern<br />
und anderen Leistungsanbietern. Dieses Fund Holding hat fünf oder sechs Jahre funktioniert,<br />
führte aber ganz logisch zu einer Konzentration bei den GP. Die guten alten<br />
Hausärzte haben sich plötzlich alle zusammengeschlossen und auf Grund der Vertrags-<br />
und Verhandlungsmacht größere Firmen gegründet. Viele Kleine konnten da nicht mithalten<br />
und wurden keine Fund Holders. Der Effekt war, dass die Patienten der großen<br />
Fund Holders, die Gutsituierten, die Gebildeten, die so etwas verstehen, verhandeln,<br />
Alternativen suchen. Bei den kleinen Praxen blieben die Ärmeren hängen. Diese Art von<br />
Vermarktlichung und Vertraglichung führt zur Selektion, zum sogenannten „Cream<br />
Skimming“. Die Leute, die Geld haben, holen sich die besseren Patienten. Jetzt ist der<br />
Wechsel umgekehrt. Die neue Regierung macht etwas ganz anderes, installiert jetzt<br />
Primary Health Care Groupes auf lokaler Ebene. Die fassen alle zusammen in Praxisnetzwerke<br />
mit Hausarztfunktion, wo nicht mehr jeder einzelne Vertrag verhandelt wird,<br />
sondern sehr viel stärker Kooperation stattfindet. Das scheint nun erheblich besser zu<br />
funktionieren. Man kann also auch im instrumentellen Bereich ganz gut sortieren, was<br />
wirklich in so eine Art von Aktivierungs-Leistungskette hineinpasst. Je mehr Einzelverträge,<br />
desto schlechter. Ich setze vielmehr auf Kooperation und Koproduktion, vor allem<br />
im Gesundheitsbereich. Das ist die eine Variante.<br />
Die andere Variante ist die dänisch-schwedische, die man mit „Agenturbildung“ bezeichnen<br />
kann, wobei quasi-autonome Instanzen geschaffen worden sind. Agentur <strong>für</strong><br />
X, Agentur <strong>für</strong> Y. Auch mit Verträgen, aber in einem beibehaltenen öffentlichen Sektor.<br />
Das funktioniert in Schweden auf Grund der hohen staatlichen Verantwortung insgesamt,<br />
wegen der geringen Verbandlichung und der geringen Korporatisierung besser,<br />
weil dort nicht -salopp gesagt- so viele Leute immer mitgeredet haben. Ich habe nichts<br />
gegen Mitbestimmung und Bürgerengagement, aber zu viele Einflüsse im Rahmen eines<br />
diffusen „Subsidiaritäts“- Prinzips, wo die Rollen gar nicht klar sind, schaffen Probleme.<br />
Das Problem der Freien Wohlfahrtsverbände z. B. ist ja, dass sie im Augenblick<br />
nicht mehr wissen, welche Rolle sie eigentlich spielen sollen. Sind sie Sozialadvokatoren<br />
<strong>für</strong> die kleinen Leute, sind sie „Dienstleister“ und Betriebe, sind sie Verbände, die<br />
Politik machen, die Verhandlungen führen, oder sind sie auf der oberen politischen Ebene<br />
die letzten, die z. B. überhaupt noch die Armutsfrage stellen? Sie stecken wirklich<br />
in einer ganz schwierigen Situation. Andere Länder haben dieses Problem nicht, weil sie<br />
andere Institutionen haben. Ich denke, dass unsere Hauptschwierigkeit darin liegt, zu<br />
klären, wie man in diesen Strukturen die Verantwortung so setzen kann, dass auch immer<br />
klar ist, dass beispielsweise Verbände, wenn sie sich auf der Ebene von Verhandlungen<br />
bewegen, dort ihre Rolle haben, aber nicht alles vermischen. Dass sie nicht behaupten,<br />
die Klienten zu vertreten. Die Krankenkassen vertreten beispielsweise die Patienten<br />
nicht. Dass hier vielmehr Autonomisierung auch im Sinne der Selbststeuerung<br />
auf den verschiedenen Ebenen eingeführt wird.<br />
Ich denke schon, dass sich insgesamt eine Richtung im internationalen Vergleich feststellen<br />
lässt. Weg von der staatlichen Fremdsteuerung, hin zu irgendeiner Art von kooperativer<br />
Selbststeuerung und verantwortungsdifferenzierenden Dezentralisierung, gerade<br />
im sozialen Dienstleistungsbereich. Und dies liegt schlicht an der neu gestellten<br />
35