Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 90 -<br />
5.8 Zusammenfassende Wertung und Ausblick<br />
Die Auswirkungen von den Schadsilagen auf die Pansenfermentation in vitro wird<br />
ausführlich in den Dissertationen von GAST (2010), GRESNER (2011),<br />
LUMPP (2011), THEERMANN (2011) und WICHERN (2011) diskutiert. Deshalb soll<br />
hier auf den Effekt der Clostridienzulage eingegangen werden.<br />
Es wurden C. botulinum Typ C und C. perfringens Typ B fünf Tage lang zugelegt.<br />
Lauf 7 und 8 bildeten hierbei die Ausnahme; ihre Zulage erfolgte über einen Zeitraum<br />
von neun Tagen. Dabei wurden entweder 1 mL oder 2 ml à 3 x 10 9 Bakterien pro mL<br />
Suspension eingesetzt. Fermentationsparameter wurden im Wesentlichen nicht<br />
beeinflusst. Eine Ausnahme bildete die Ammoniakkonzentration, die sich durch den<br />
Zusatz von Clostridien veränderte. Sonst zeigte sich weder eine Wirkung auf den pH-<br />
Wert, die Gasproduktion, die restlichen flüchtigen Fettsäuren oder die Summe aller<br />
Fettsäuren noch auf die Vitalität der Protozoen.<br />
Da Clostridien ubiquitär vorkommende Keime sind, ist ein Eintrag durch Schmutz in<br />
Silagemieten nicht unwahrscheinlich. Die Keime sollten allerdings durch eine optimale<br />
Silierung in ihrer Vermehrung gehemmt werden. Besonders gefährdet sind<br />
nasse und verschmutzte Silagen, da Clostridien eine feuchte Umgebung bevorzugen<br />
und durch einen höheren osmotischen Druck in angewelktem Material gehemmt<br />
werden (ADLER 2002). In den Silagen sind Clostridien vorwiegend wegen des Umbaus<br />
von Kohlenhydraten, Milchsäure und verschiedenen Aminosäuren unerwünscht.<br />
Es entstehen Buttersäure, Essigsäure, Kohlensäure und Wasserstoff<br />
(GROSS u. RIEBE 1974). Da Buttersäure weniger sauer wirkt als Milchsäure und<br />
aus 2 mol Milchsäure nur 1 mol Buttersäure entsteht, wird der Konservierungseffekt<br />
nicht erreicht (GRIES 2008). Von besonderer Bedeutung für eine Kontamination mit<br />
Clostridien sind Silagen, die zu nass einsiliert wurden oder die einen hohen Verschmutzungsgrad<br />
aufweisen (NUSSBAUM 2002). Hierbei kann es zu Gärfehlern;<br />
aber auch zu einer Vermehrung und Toxinbildung von Clostridien kommen. Verschmutzung<br />
und Nässe treten häufiger im Herbstschnitt auf (GRIES 2008). Demnach<br />
müsste es vermehrt durch die im Herbst gewonnene Silage zu clostridial bedingten<br />
Erkrankungen kommen. Die in Kapitel 2.4 beschriebene „Faktorenerkrankung Milchviehherde“<br />
tritt hingegen besonders nach der Verfütterung von Silage aus dem<br />
ersten Schnitt auf.<br />
Ein Eintrag von Clostridien aus alternativen Quellen unabhängig von der Grassilage,<br />
kann allerdings nicht ausgeschlossen werden.<br />
Durch die PCR der RuSiTec-Proben wurde untersucht, ob toxinbildendes Gen in den<br />
Proben vorhanden war. Daraus ließ sich nicht ableiten, ob die Clostridien zu diesem<br />
Zeitpunkt lebendig oder bereits tot waren. Wäre letzteres der Fall, könnte eine<br />
Ansiedlung im Darm ausgeschlossen werden, da so keine lebensfähigen Clostridien<br />
die unteren Darmabschnitte erreichen könnten. Um das herauszufinden, wäre eine<br />
Anzucht der Clostridien aus den Fermenterproben sinnvoll. Interessant ist hierbei<br />
auch der Unterschied zwischen der Kombination aus Clostridien und Kontrollsilage<br />
bzw. den beiden Schadsilagen. Es stellt sich die Frage, ob durch den verminderten<br />
Reineiweißanteil ein Überleben der Clostridien im Pansen begünstigt wird.


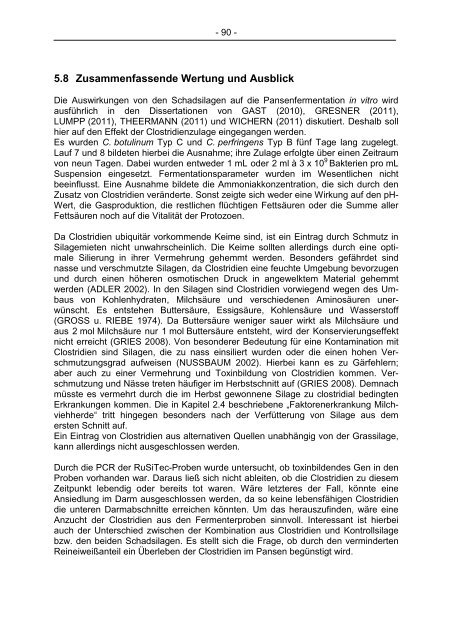



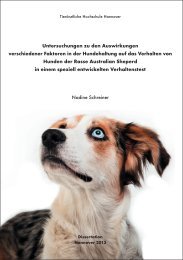



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






