Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 17 -<br />
REINSTEIN et al. 2007; CALLAWAY et al. 2008). Auch hier korrelierte die Form der<br />
Fütterung mit dem Ausmaß der Ausscheidung über den Kot. DEPENBUSCH et al.<br />
(2008) wiesen nach, dass Stiere, die nach Kornfütterung positiv auf E. coli O157:H7<br />
getestet wurden 21 % mehr fäkale Stärke aufwiesen als negativ getestete Tiere.<br />
Fasten förderte die Kolonisation von E. coli O157:H7, vermutlich da hier die Gehalte<br />
an flüchtigen Fettsäuren im Pansen absanken (CALLAWAY et al. 2003). HARMON<br />
et al. (1999) stellte hingegen fest, dass eine Hungerperiode zwar den Gehalt an<br />
flüchtigen Fettsäuren reduzierte, dies aber keinen Einfluss auf die Ausscheidung von<br />
E. coli O157:H7 hatte.<br />
2.4.3.2 Limitierende Faktoren für das Wachstum von<br />
Escherichia coli im Pansen<br />
Das Milieu im Pansen bietet E. coli in Bezug auf obligate Anaerobiose, pH-Wert,<br />
sowie Temperatur akzeptable Lebensbedingungen. Wie ruminale Bakterien stellen<br />
auch E. coli nur geringe Ansprüche an ihre Umgebung (BRYANT 1959). Dennoch<br />
gibt es Limitierungsfaktoren, wie<br />
1. eine ungenügende Zahl aufgenommener E. coli, die sich gegen die originäre<br />
Flora durchsetzen muss<br />
2. Unvermögen Nährstoffe aus dem Pansensaft oder dem Futter aufzunehmen<br />
3. Inhibitoren wie antibiotisch wirksame Stoffe, Fermentationsprodukte oder<br />
Kohlendioxid<br />
4. Lysis durch Bakteriophagen<br />
HOLLOWELL und WOLIN (1965) haben diese möglichen Limitierungsfaktoren<br />
experimentell überprüft. Ihnen erschien die Möglichkeit, dass E. coli unzureichend<br />
Nährstoffe für das Wachstum im Pansen aufnehmen kann am wahrscheinlichsten, da<br />
es weder Stärke noch Cellulose fermentiert und von anderen Organismen keine<br />
ausreichenden Mengen an freien Zuckern produziert werden. Andererseits ist es in<br />
der Lage Ammoniak zu nutzen. Experimentell wurde die These durch Zugabe von<br />
Lactose zur normalen Ration in einem in vitro-System getestet, konnte aber nicht<br />
bestätigt werden. Auch WALLACE et al. (1989) vermuteten einen Vorteil für<br />
Bakterien, die sich für gewöhnlich nicht im Pansen ansiedeln können, durch Zugabe<br />
von langsam metabolisierbaren Zuckern und Zuckerderivaten. Sie überprüften in vivo<br />
die Möglichkeit durch Zugabe von Sorbitol eine Ansiedlung von E. coli im Pansen<br />
von Schafen zu ermöglichen, da Sorbitol ein rasches kulturelles Wachstum im<br />
Medium mit Zusatz von 20 % Pansensaft bei pH 7,0 förderte (WALLACE et al. 1989).<br />
Allerdings führte die E. coli-Inkubation bei Schafen mit Sorbitolzugabe in den Pansen<br />
nicht nur nicht zu Wachstum, sondern nicht einmal zu längerem Überleben der<br />
Bakterien (WALLACE et al. 1989).<br />
Auch eine höhere Inokulation führte nicht zur Etablierung von E. coli (HOLLOWELL<br />
u. WOLIN 1965). Hier wurde der Grund ebenfalls in den flüchtigen Fettsäuren, die<br />
sich physiologischerweise im Pansen akkumulieren, vermutet. Es zeigte sich eine<br />
pH-Abhängigkeit der Wirkung: die hemmende Wirkung isolierter Fettsäuren auf


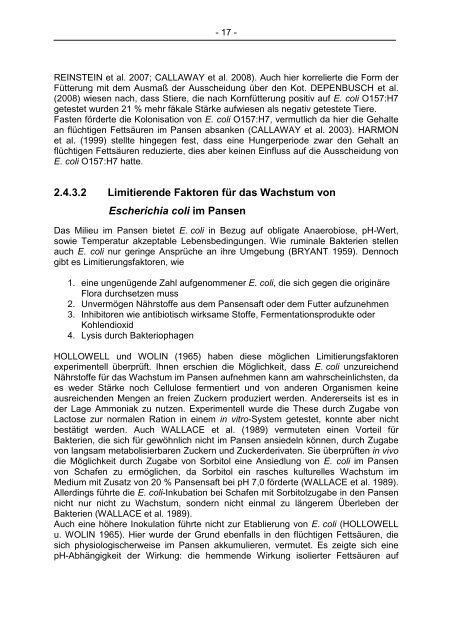



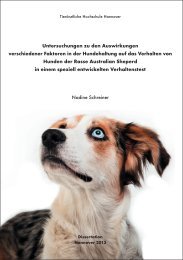



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






