Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 19 -<br />
der Überlebensfähigkeit darstellt. Ohne Nahrungskarenz kam es auch bei größerer<br />
Anzahl an Empfängern und Donatoren zu keiner Übertragung, weder zwischen<br />
verschiedenen E. coli-Stämmen, noch zwischen E. coli und Salmonella-Spezies.<br />
Während einer Hungerperiode zeigten GRAU und BROWNLIE (1968) hingegen eine<br />
Vermehrung von E. coli im Pansen auf das 2000fache. Eine anschließende Wiederaufnahme<br />
der Fütterung ließ die Anzahl erneut ansteigen. Nach sieben Tagen war<br />
kein Nachweis im Pansensaft mehr möglich. In einer Studie mit adulten Schafen,<br />
welche direkt mit E. coli-Stämmen ruminal inokuliert wurden, konnte SMITH (1975)<br />
die Übertragung eines R-Faktors mit Antibiotikaresistenz zwischen E. coli-Stämmen<br />
sowie eine Vermehrung lediglich nach einer Hungerphase von mindestens<br />
24 Stunden nachweisen. 1977 bewies SMITH diese Übertragung unter gleichen<br />
Bedingungen auch von E. coli auf Salmonella-Spezies. Nach weniger als 48 h<br />
Nahrungskarenz vermehrten sich sowohl E. coli als auch die Salmonellen, so dass<br />
eine ausreichend große Anzahl erreicht werden konnte, um einen Transfer des<br />
R-Faktors zu erreichen.<br />
Generell ist die Ausscheidung mit dem Kot nach Inokulation von E. coli in den<br />
Pansen von Rindern bei Kälbern höher als bei ausgewachsenen Tieren (CRAY u.<br />
MOON 1995), da letztere über ein voll ausgebildetes Vormagensystem verfügen, in<br />
dem durch entsprechende pH-Werte und Konzentrationen an flüchtigen Fettsäuren<br />
eine Vermehrung und somit eine längere Ausscheidung verhindert werden. Die<br />
Gesundheit wurde weder von erwachsenen Tieren noch von Kälbern durch die<br />
experimentelle orale Infektion mit E. coli beeinträchtigt (CRAY u. MOON 1995).<br />
Aber auch Protozoen sorgen für eine Limitierung von E. coli im Pansen. Bereits<br />
innerhalb einer Stunde nach Ingestion von E. coli konnten WALLIS und COLEMAN<br />
(1967) kein lebensfähiges Bakterium mehr in den Protozoen in vitro nachweisen.<br />
2.4.3.3 Überleben von Escherichia coli und anderen coliformen<br />
Keimen in Protozoen<br />
Um Infektionen bei Wiederkäuern auslösen zu können, muss E. coli die<br />
Magenpassage überleben. Unter physiologischen Umständen wird die Anzahl von<br />
E. coli von den im Pansen habitierten Protozoen limitiert. BARKER et al. (1999)<br />
zeigten, dass ein Überleben und Vermehren von E. coli in Futtervakuolen von<br />
Acanthamoeba polyphaga, einem ubiquitär vorkommenden Einzeller, möglich ist. Der<br />
normale digestive Cyclus der meisten Amoeben dauert eine bis vier Stunden, bevor<br />
das verdaute Material ausgeschieden wird (KWAN 1973). SCHLIMME et al. (1997)<br />
zeigten, dass nach der Fütterung von Wasseramoeben über 90 % der ausgeschiedenen<br />
Partikel lebensfähige E. coli enthielt. Eine hohe Bakteriendichte und das<br />
Vorhandensein von vielen Vakuolen förderte das Überleben der E. coli. Ein Grund<br />
hierfür lag in der schnelleren Eliminierung der Vakuolen, wenn viele von ihnen<br />
vorhanden waren (NILSSON 1972). Bevor über die Lysosomen eine Verdauung der<br />
Bakterien vollzogen werden konnte, wurden diese bereits wieder ausgeschieden.<br />
KING et al. beschrieb 1988 das Überleben von coliformen Keimen in Wasserprotozoen<br />
während der Chlorierung. Frei lebende Bakterein wurden während des<br />
Versuchs innerhalb einer Minute bei einem Chlorgehalt von ≥1 mg/L inaktiviert. Nach






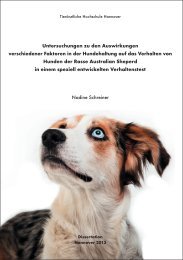



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






