Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 11 -<br />
2.4.1.1 Eintragsquellen von Clostridium botulinum und anderen<br />
Clostridien in die Wiederkäuerration<br />
Eine Eintragsquelle von C. botulinum in die Wiederkäuerration ist die Kontamination<br />
von Futtermitteln mit sporenhaltigen Kadavern von Kleinnagern und Wildtieren, die u.<br />
a. von Erntemaschinen verpresst wurden (GALEY et al. 2000; WEIßBACH 2004),<br />
oder von mit Erde verunreinigten Grobfuttermitteln (BÖHNEL u. GESSLER 2004;<br />
WEIßBACH 2004). Auch in Bioabfällen (BÖHNEL u. LUBE 2000) und Kompostproben<br />
(SCHIMMEL 2002) wurden Toxine gefunden. Dabei wurde Typ B Botulismus<br />
dem Einsatz mangelhaft silierter Heulage zugeschrieben (SCHIMMEL 2002), trat<br />
aber auch nach Verwendung von Biertreber auf (BREUKINK et al. 1978).<br />
Typ C Botulismus wurde nach Verfütterung von Futtermitteln diagnostiziert, die<br />
Kadaver oder Geflügelmist enthielten, die mit dem Bakterium oder Toxin belastet<br />
waren. Diese Form führte zu Hemmung der Pansenmotorik, Erniedrigung des<br />
Schwanztonus und Festliegen, wahrscheinlich ausgelöst durch Tetraparese (JEAN et<br />
al. 1995). Typ D Botulismus stand in Verdacht, durch die Aufnahme von Knochen<br />
toter Tiere hervorgerufen worden zu sein (ROCKE et al. 2008).<br />
Die Aufrechterhaltung des Kreislaufs von C. botulinum wird der landwirtschaftlichen<br />
Nutzung zugeschrieben. Keime werden mit dem Kot ausgeschieden, über Gülle und<br />
Einstreu auf die Felder gebracht und können somit in pflanzliche Futtermittel<br />
gelangen. KALZENDORF (2004) beschrieb eine geringere Clostridienbelastung in<br />
Grassilagen nach Einsatz eines mineralischen Düngers als nach Güllebedüngung.<br />
Ein Vorkommen von C. botulinum ist im Kot gesunder Haustierbestände durchaus<br />
üblich (NOTERMANS et al. 1978), wobei saisonale Schwankungen bestehen. Im<br />
Sommer wurden < 1,5 Sporen/g nachgewiesen, im Winter > 4 Sporen/g. Als Grund<br />
hierfür wird eine vermehrte Silagefütterung im Winter vermutet. Silage kann auf die<br />
oben beschriebenen Wege verunreinigt werden. Vorhandene Sporen gelangen so in<br />
die Mieten, ihr Auskeimen wird durch anaerobes Milieu begünstigt. Eine Vermehrung<br />
von C. botulinum ist ab einem pH-Wert von > 4,5 und einer Wasseraktivität > 0,985<br />
(TS < 25 %) möglich (MEYER u. COENEN 2002). Nitratarme Ausgangsmaterialien<br />
be-günstigten dies, da die fehlenden nitrosen Gase ihre hemmende Wirkung nicht<br />
ausüben konnten (POLIP 2001). HAAGSMA und TER LAAK (1979) wiesen<br />
10 4 Keime/g in toxinhaltiger Grassilage nach, die bei Rindern Typ B-Botulismus<br />
auslöste. Ähnliche Fälle wurden in verschiedenen Ländern beschrieben (HAAGSMA<br />
u. TER LAAK 1979; ABBITT et al. 1984; DIVERS et al. 1986; POPOFF u.<br />
LECOANET 1987; HOGG et al. 1990; JEAN et al. 1995; YERUHAM et al. 2003).<br />
Eine Zusammenfassung der möglichen Vektoren für den Eintrag von Clostridien in<br />
Futtermittel ist in Tab. 2.5 aufgeführt.






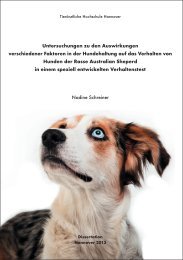



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






