- Seite 1 und 2: Tierärztliche Hochschule Hannover
- Seite 3: „Was wir wissen, ist ein Tropfen,
- Seite 6 und 7: II 3.5 Literaturangabe zur Analyse
- Seite 8 und 9: Abkürzungsverzeichnis AS Aminosäu
- Seite 12 und 13: 2 Literaturübersicht 2.1 Der Panse
- Seite 14 und 15: - 4 - 2.2.1 Fermentation von Futter
- Seite 16 und 17: - 6 - isoliert, fand NOUZAREDE (197
- Seite 18 und 19: - 8 - 3. Isolierung des Bakteriums
- Seite 20 und 21: 2.4 Fremdbakterien im Pansen - 10 -
- Seite 22 und 23: - 12 - Tab. 2.5: Mögliche Vektoren
- Seite 24 und 25: - 14 - Clostridien noch mindestens
- Seite 26 und 27: - 16 - Bei Kälbern kann eine Dysfu
- Seite 28 und 29: - 18 - E. coli trat erst bei niedri
- Seite 30 und 31: - 20 - der Aufnahme durch die Amoeb
- Seite 32 und 33: - 22 - Empfänger und dem protozoen
- Seite 34 und 35: - 24 - (1,06 ± 0,18 x 10 9 Salmone
- Seite 36 und 37: - 26 - Nähere Angaben zum Aufbau d
- Seite 38 und 39: 3.4.1 Versuche - 28 - Ein Lauf daue
- Seite 40 und 41: Tab. 3.3: Übersicht der Probenentn
- Seite 42 und 43: - 32 - Fortsetzung Tab. 3.4 Lauf 7
- Seite 44 und 45: 3.8 Färbeversuche der Protozoen 3.
- Seite 46 und 47: - 36 - Tab. 3.7: Farbstoffe im Vorv
- Seite 48 und 49: - 38 - Fortsetzung Tab. 3.8 Malachi
- Seite 50 und 51: - 40 - schwache Färbung ausgeschlo
- Seite 52 und 53: - 42 - Fortsetzung Tab. 3.11 Trypan
- Seite 54 und 55: - 44 - bad. Ein Deckel verhinderte
- Seite 56 und 57: - 46 - Wesentlichen stimmten die Er
- Seite 58 und 59: - 48 - dafür eine Vielzahl grampos
- Seite 60 und 61:
- 50 - Tab. 4.1: Prozentualer Unter
- Seite 62 und 63:
mmol/L 27 18 9 0 - 52 - Abb. 4.2: A
- Seite 64 und 65:
mmol/L 27 18 9 0 - 54 - 0 2 4 6 8 1
- Seite 66 und 67:
- 56 - 9.154). Bei Zulage von K-01
- Seite 68 und 69:
- 58 - Fortsetzung Tab. 4.5 C. botu
- Seite 70 und 71:
- 60 - Die Essigsäureproduktion ze
- Seite 72 und 73:
- 62 - Die n-Valeriansäureprodukti
- Seite 74 und 75:
Tab. 4.11: Mittlere prozentuale Eff
- Seite 76 und 77:
4.2 Motilität der Protozoen - 66 -
- Seite 78 und 79:
- 68 - wieder ein. Der Protozoenant
- Seite 80 und 81:
- 70 - Zulage der anderen Silagen (
- Seite 82 und 83:
- 72 - Fortsetzung Tab. 4.14 Kontro
- Seite 84 und 85:
- 74 - 5.2.2 Beurteilung der verwen
- Seite 86 und 87:
- 76 - 9.4). Darüber hinaus wurden
- Seite 88 und 89:
- 78 - Wurde das Heu gegen die Gras
- Seite 90 und 91:
- 80 - Nach Absetzen der Silage err
- Seite 92 und 93:
% 70 30 -10 Schadsilagenzulage- mik
- Seite 94 und 95:
- 84 - In der Literatur gibt es kei
- Seite 96 und 97:
- 86 - Dabei betragen die physiolog
- Seite 98 und 99:
- 88 - Tab. 5.2: Prozentualer Vergl
- Seite 100 und 101:
- 90 - 5.8 Zusammenfassende Wertung
- Seite 102 und 103:
- 92 - C. perfringens Typ B würden
- Seite 104 und 105:
- 94 - Die Schadgrassilage S-05 bew
- Seite 106 und 107:
- 96 - Chart 7.1: Percentual increa
- Seite 108 und 109:
- 98 - BALDASSARRI, L., G. DONELLI,
- Seite 110 und 111:
- 100 - BRENNER, D. J., N. R. KRIEG
- Seite 112 und 113:
- 102 - COLEMAN, G. S. (1972): The
- Seite 114 und 115:
- 104 - DIVERS, T. J., R. C. BARTHO
- Seite 116 und 117:
- 106 - DELAFUENTE, G., M. FONDEVIL
- Seite 118 und 119:
- 108 - HAAGSMA, J., u. E. A. TER L
- Seite 120 und 121:
- 110 - HUNGATE, R. E., R. W. DOUGH
- Seite 122 und 123:
KWAN, W. J. (1973): The biology of
- Seite 124 und 125:
- 114 - MATTILA, T. A., J. FROST u.
- Seite 126 und 127:
OGIMOTO, K., u. S. IMAI (1981): Atl
- Seite 128 und 129:
- 118 - ROLLE, M., u. A. MAYR (2002
- Seite 130 und 131:
- 120 - SLYTER, L. L., R. R. OLTJEN
- Seite 132 und 133:
- 122 - TJABERG, T. B. (1973): Prot
- Seite 134 und 135:
- 124 - YERUHAM, I., D. ELAD, Y. AV
- Seite 136 und 137:
- 126 - Tab. 9.4: Untersuchungserge
- Seite 138 und 139:
Fortsetzung Tab. 9.7 D-Norvalin Sig
- Seite 140 und 141:
- 130 - Anreicherung: • Stomacher
- Seite 142 und 143:
- 132 - DNA-Isolierung für gram-po
- Seite 144 und 145:
- 134 - DNAX + BoNT C1 positiv, BoN
- Seite 146 und 147:
- 136 - PCR-Bedingungen Nachweis vo
- Seite 148 und 149:
9.6 Statistische Daten - 138 - Die
- Seite 150 und 151:
Tab. 9.11: pH-Werte in der Fermente
- Seite 152 und 153:
Tab. 9.15: Ammoniakkonzentration (m
- Seite 154 und 155:
Tab. 9.19: Überstandsvolumen (mL)
- Seite 156 und 157:
Tab. 9.23: Überstandsvolumen (mL)
- Seite 158 und 159:
Tab. 9.27: Gasproduktion (mL) währ
- Seite 160 und 161:
Tab. 9.31: Methankonzentration (Vol
- Seite 162 und 163:
Tab. 9.35: Wasserstoffkonzentration
- Seite 164 und 165:
Tab. 9.39: Kohlendioxidkonzentratio
- Seite 166 und 167:
Tab. 9.43: Kohlendioxidkonzentratio
- Seite 168 und 169:
Tab. 9.47: Stickstoffkonzentration
- Seite 170 und 171:
Tab. 9.51: Sauerstoffkonzentration
- Seite 172 und 173:
Tab. 9.55: Proteingehalt (µg/mL RS
- Seite 174 und 175:
Tab. 9.59: Essigsäurekonzentration
- Seite 176 und 177:
Tab. 9.63: Essigsäurekonzentration
- Seite 178 und 179:
Tab. 9.67: Essigsäureproduktion (m
- Seite 180 und 181:
Tab. 9.71: Propionsäurekonzentrati
- Seite 182 und 183:
Tab. 9.75: Propionsäureproduktion
- Seite 184 und 185:
Tab. 9.79: i-Buttersäurekonzentrat
- Seite 186 und 187:
Tab. 9.83: i-Buttersäurekonzentrat
- Seite 188 und 189:
Tab. 9.87: i-Buttersäureproduktion
- Seite 190 und 191:
Tab. 9.91: n-Buttersäurekonzentrat
- Seite 192 und 193:
Tab. 9.95: n-Buttersäureproduktion
- Seite 194 und 195:
Tab. 9.99: i-Valeriansäurekonzentr
- Seite 196 und 197:
Tab. 9.103: i-Valeriansäurekonzent
- Seite 198 und 199:
Tab. 9.107: i-Valeriansäureprodukt
- Seite 200 und 201:
Tab. 9.111: n-Valeriansäurekonzent
- Seite 202 und 203:
Tab. 9.115: n-Valeriansäureprodukt
- Seite 204 und 205:
Tab. 9.119: Hexansäurekonzentratio
- Seite 206 und 207:
Tab. 9.123: Hexansäurekonzentratio
- Seite 208 und 209:
Tab. 9.127: Hexansäureproduktion (
- Seite 210 und 211:
Tab. 9.131: Summe aller flüchtigen
- Seite 212 und 213:
Tab. 9.135: Produktion aller flüch
- Seite 214 und 215:
9.7 Prozentualer Vergleich der vers
- Seite 216 und 217:
Tab. 9.141: Prozentualer Unterschie
- Seite 218 und 219:
Tab. 9.143: Prozentualer Unterschie
- Seite 220 und 221:
9.8 Vergleich zwischen der alleinig
- Seite 222 und 223:
Tab. 9.146: Vergleich der Silagezul
- Seite 224 und 225:
Tab. 9.148: Vergleich der Silagezul
- Seite 226 und 227:
Tab. 9.150: Vergleich der Silagezul
- Seite 228 und 229:
Tab. 9.152: Vergleich der Silagezul
- Seite 230 und 231:
Tab. 9.154: Vergleich der Silagezul
- Seite 232 und 233:
Tab. 9.156: Vergleich der Silagezul
- Seite 234 und 235:
Tab. 9.158: Vergleich der Silagezul
- Seite 236 und 237:
Tab. 9.160: Prozentualer Unterschie
- Seite 238 und 239:
9.9 Prozentuale Verteilung der Hefe
- Seite 240 und 241:
Tab. 9.166: Prozentuale Verteilung
- Seite 242:
Danksagung Zunächst möchte ich He






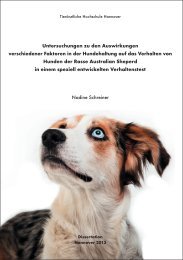



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






