Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 13 -<br />
gegen B-M nur minimal toxischer wurde. Die Steigerung der Toxizität bei B-L wurde<br />
proteolytischen Enzymen im Panseninhalt zugeschrieben (KOZAKI u. NOTERMANS<br />
1980). Daher sind diese bei Intoxikationen des Rindes von besonderer Bedeutung<br />
(KOZAKI u. NOTERMANS 1980).<br />
KOZAKI u. NOTERMANS (1980) folgerten aus den Untersuchungen von ALLISON<br />
et al. (1976), dass eine Intoxikation beim Wiederkäuer nur dann auftritt, wenn die aufgenommene<br />
Toxinmenge das Abbauvermögen des Pansens überschreitet. So wirkte<br />
auch beispielsweise die subkutane Applikation einer Botulinumtoxin Typ D Aufbereitung<br />
bereits in einer Dosierung von 0,00025 mL/kg KGW letal, während die orale<br />
Gabe der hundertfachen Dosis (0,025 mL/kg KGW) überlebt wurde (SIMMONS u.<br />
TAMMEMAGI 1964; ALLISON et al. 1976).<br />
Nach oraler Aufnahme ist das Schicksal der Toxine im Pansen von Interesse. Im<br />
gesunden Pansensaft wurde eine Inaktivierung von C. botulinum Toxin Typ C sowohl<br />
bei Rindern als auch bei Schafen nachgewiesen (ALLISON et al. 1976). Hierbei<br />
wurde einem Schaf und einem Rind aus einer Pansenfistel Panseninhalt<br />
entnommen. Die Tiere wurden mit Luzernehäckseln, bzw. Luzerneheu gefüttert. Die<br />
Pansensaft-proben wurden 16 bis 18 Stunden nach der Fütterung in isolierte<br />
Flaschen gefüllt. Nach der Filterung durch eine doppelte Schicht Mullbinde wurde der<br />
Pansensaft in ein Polypropylenröhrchen mit Gummistopfen gefüllt und mit CO2<br />
begast. Eine Nadel im Gummistopfen leitete das entstehende Gas ab. Das<br />
Botulinumtoxin Typ C wurde in einem Verhältnis 1:50 (Vol./Vol.) dem Pansensaft<br />
zugesetzt. Die Toxizität der Lösung wurde im Mäuseversuch überprüft. In<br />
Abhängigkeit von der Dosis wurde das Toxin nach 30 Min. bis vier Stunden<br />
Inkubationsdauer vollständig inaktiviert. Hierfür waren augenscheinlich<br />
Pansenbakterien verantwortlich, welche die Botulinumtoxine abbauten; zellfreier<br />
Pansensaft zeigte keine inaktivierende Wirkung und Fraktionen, die neben Protozoen<br />
nur wenige Bakterien enthielten, hatten einen deutlich geringeren inaktivierenden<br />
Effekt. Diese Fraktionen wurden durch Zentrifugation mit 500 xg für 5 Min., bzw.<br />
20000 xg für 10 Min. hergestellt (ALLISON et al. 1976). Die Pansenbakterien<br />
verfügen demnach über proteolytische Enzyme, da es sich beim BoNT um ein<br />
Protein handelt. Dieses Ergebnis stimmt mit der Erkenntnis überein, dass<br />
proteolytische Enzyme im Pansen nicht frei sondern zellassoziiert sind<br />
(BLACKBURN 1968). Während des Abbauprozesses wurde die Gasproduktion<br />
gesteigert. Bei einem erhöhten Angebot anderer Proteine vermuten ALLISON et al.<br />
(1976) eine Verringerung des Toxinabbaus.<br />
2.4.1.3 Clostridium botulinum im Verdauungstrakt<br />
Angaben zur möglichen Vermehrung von C. botulinum (Typ B) und zur Toxinbildung<br />
im Magen-Darm-Trakt des Rindes sind widersprüchlich. Während Untersuchungen<br />
durch HAAGSMA und TER LAAK (1978b) keine Hinweise auf eine Vermehrung und<br />
Toxinbildung in vivo lieferten, schlossen NOTERMANS et al. (1978) diese Möglichkeit<br />
nicht aus: Bei Verfütterung kontaminierten Malzes (6x10 5 -10 6 C. botulinum Typ<br />
B-Keime/g) an Rinder wurden Clostridiengehalte in Panseninhalt und Faeces von<br />
10 5 -10 7 Keime/g erreicht. Nach Absetzen der Malzfütterung ließen sich die


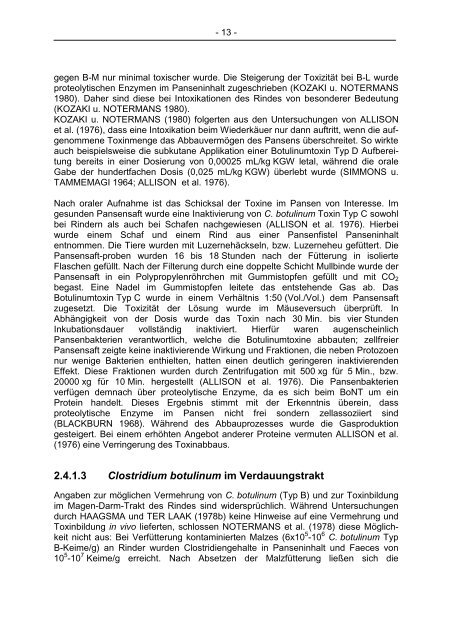



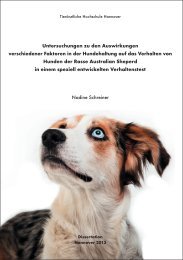



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






