Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 85 -<br />
5.6.2.3 Bakterieller Proteingehalt<br />
Ein Einfluss durch die Clostridien auf den Proteingehalt im Kompartiment 1 konnte im<br />
Versuchsverlauf nicht festgestellt werden. Im Gegenteil blieb der Wert, der im<br />
flüssigen RuSiTec-Inhalt gemessen wurde, während des gesamten Versuchs stabil.<br />
Demnach kam es wahrscheinlich auch durch die Silagezulage nicht zu einer Zu- oder<br />
Abnahme der Bakterienzahl in der Fermenterflüssigkeit.<br />
Beim Vergleich des Proteingehalts bei Einsatz einer Kombination aus Silage und<br />
Clostridien mit der reinen Silagegabe zeigte sich der Proteingehalt bei Kombinationszulage<br />
prozentual höher (s. Tab. 4.6). Außerdem erhöhte die Verdopplung der<br />
Clostridienmenge den prozentualen Unterschied noch weiter. Ein möglicher Erklärungsansatz<br />
könnte eine Störung der Protozoen sein. Bei deren Zugrundegehen<br />
würde Protein frei, welches dann in der Proteinmessung erscheinen würde (s.<br />
GRESNER 2011). Gründe für ein Absterben von Pansenprotozoen durch Clostridien<br />
sind in der Literatur nicht zu finden. Setzt man allerdings voraus, dass ein Überleben<br />
oder sogar eine Vermehrung von Clostridien in Protozoen möglich ist, könnten ihre<br />
Auswirkungen auf die Wirtszelle mit denen von Salmonella übereinstimmen. GAZE et<br />
al. (2003) beschrieb das Zugrundegehen von Acanthamoeba polyphaga durch<br />
Störung der Osmoregulation nach Besiedlung mit Salmonellen in kontraktilen<br />
Vakuolen oder Futtervakuolen (vergl. Kap. 2.4.4.2). Dieser Ablauf könnte auch auf<br />
Pansenprotozoen zutreffen, ist in der Literatur allerdings bisher nicht beschrieben<br />
worden. Eine zweite Möglichkeit zur Beeinträchtigung der Protozoen durch Clostridien<br />
besteht durch die Wirkung des gebildeten Toxins. STÄNDER (2007) diskutierte<br />
die Möglichkeit, dass BoNT an SNARE-Proteinen von Protozoen (Tetrahymena<br />
pyriformis als Modellorganismus) wirken können und somit die Zelle beeinträchtigen.<br />
Beweisen konnte STÄNDER (2007) diese Theorie durch seine Versuche allerdings<br />
nicht. Er vermutete, dass die eingesetzte Neurotoxinkonzentration zu niedrig war, um<br />
einen Einfluss auf Tetrahymena pyriformis auszuüben.<br />
Durch den vorliegenden Versuch kann keine Aussage über ein mögliches<br />
protozoales Absterben getroffen werden. Die Clostridienzulage beeinträchtigte die<br />
Vitalität der Protozoen im RuSiTec nicht, aber eine Zählung wurde nicht<br />
vorgenommen, so dass es nicht möglich ist zu sagen, ob die Protozoen zur<br />
Erhöhung des Proteins führten.<br />
5.6.3 Auswirkungen auf den Kohlenhydratstoffwechsel<br />
Im Kohlenhydratstoffwechsel entstehen Essig-, Propion-, n-Butter-, n-Valerian- und<br />
Hexansäure. Diese wurden während der RuSiTec-Versuche mittels Gaschromatographie<br />
bestimmt. An dieser Stelle wird auch die Produktion aller flüchtigen Fettsäuren<br />
diskutiert.<br />
Durch Hinzufügen von Clostridien in die Fermenter wurde der Verlauf der Produktion<br />
der Summe der flüchtigen Fettsäuren, der n-Valerian- und der Hexansäure nicht beeinflusst.<br />
Der Anteil von Essigsäure, Propionsäure und Buttersäure an den flüchtigen Fettsäuren,<br />
die im Pansen produziert werden, beträgt mehr als 95 % (PFEFFER 1987).






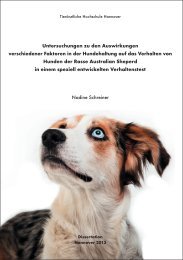



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






