Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Doktorarbeit Endversion - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 74 -<br />
5.2.2 Beurteilung der verwendeten Futtermittel<br />
Die eingesetzten Silagen waren identisch mit denen aus den Dissertationen GAST<br />
(2010), GRESNER (2011) und LUMPP (2011) und wurden daher bereits ausführlich<br />
kritisch beurteilt.<br />
Zu beachten ist die Lagerung der Silagen, die bei den vorangegangenen Versuchen<br />
ein Jahr betrug (näheres s. GAST 2010) und zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchungen<br />
ein weiteres Jahr bei -18 °C fortgesetzt wurde. Hierbei waren die Lagerungsbedingungen<br />
für alle Silagen gleich.<br />
5.2.3 Beurteilung der eingesetzten Clostridien<br />
Clostridium botulinum und C. perfringens wurden für die Versuche ausgewählt, da es<br />
sich um ubiquitär vorkommende Keime handelt, die zu Erkrankungen in<br />
Rinderbeständen führen können. Die Optimaltemperatur von Clostridien liegt<br />
zwischen 37 °C und 45 °C liegt und auch ein pH-Wert zwischen 5,5 und 8,0 für das<br />
Wachstum positiv ist (JAY et al. 2005), waren die Bedingungen im RuSiTec, was<br />
diese Parameter betrifft, für das Überleben und die Vermehrung der Bakterien als gut<br />
zu bewerten.<br />
Bei der Auswahl der Toxintypen zur Inokulation im RuSiTec waren zwei Aspekte von<br />
Bedeutung. Zum einen sollten es Toxintypen sein, die dafür bekannt sind Erkrankungen<br />
beim Rind auszulösen und regelmäßig in der Umwelt angetroffen werden,<br />
zum anderen musste eine Anzucht unter Laborbedingungen möglich sein, um zum<br />
Zeitpunkt der Zulagephase in ausreichender Menge zur Verfügung zu stehen. Daher<br />
wurden C. botulinum Typ C (CCUG 7970) und C. perfringens Typ B (CCUG 2035)<br />
eingesetzt. Die Fähigkeit zur Spaltung von Proteinen und Peptiden ist von<br />
besonderer Bedeutung in der vorliegenden Studie, da während der Versuche<br />
Material in Form von Silagen in den RuSiTec eingebracht wurde, welches<br />
unterschiedliche Anteile an freien Aminosäuren enthielt (s. Tab. 9.5), die schnell zum<br />
Abbau zur Verfügung standen. Bestünde für die Clostridien keine Möglichkeit zur<br />
Proteolyse, wären die freien Aminosäuren ein wichtiger Faktor für das Überleben und<br />
Wachstum dieser Fremdbakterien. C. botulinum Typ C wurde in der Literatur als<br />
generell nicht proteolytisch aktiv beschrieben (EKLUND u. POISKY 1972; BRENNER<br />
et al. 1986). Jedoch bei einzelnen wenigen Stämmen entdeckten SKULBERG (1964)<br />
sowie TJABERG (1973) proteolytische Aktivität, wobei sich toxinogene Stämme<br />
immer als nicht zur Proteolyse fähig herausgestellt hatten. Verschiedene Medien<br />
förderten die Expression der Proteasen (Magermilch-Agar eignete sich am besten,<br />
mit Zusatz von Hefe gab es gleiche Ergebnisse, schlechter waren Proteose-Peptone-<br />
Trypticase-Yeast-Extrakt-Glucose-Medium und Robertsons Fleischbrühe). Die<br />
Expression von Proteasen war aber deutlich geringer als bei den Clostridien, die<br />
andere Toxintypen bildeten (TJABERG 1973). TJABERG (1973) fand bei seinen






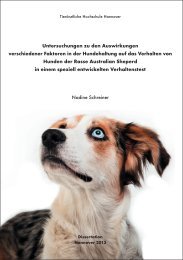



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






