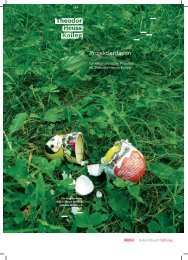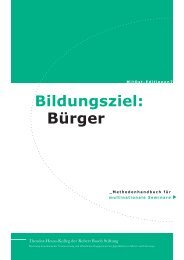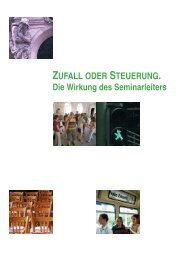pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
▌ Gedenktage<br />
Die politische Selbstbeschreibung einer Gesellschaft kann insbesondere an ihren<br />
Traditionsbezügen abgelesen werden. In diesem Sinn ist Politik eingebettet in eine »Er-<br />
innerungskultur« als einem Teilbereich der Politischen Kultur. Die gezielt diese Selbstbe-<br />
schreibung beeinflussende Form der Politik ist die »Geschichtspolitik.« Steinbach schlägt<br />
die definitorische Brücke zum Bereich politischen Handelns: »Deutungen der Vergangen-<br />
heit sind nicht selten das Ergebnis politischer Auseinandersetzungen, der 'Geschichtspoli-<br />
tik'. Geschichte ist somit nicht mehr allein das Ergebnis vergangener Politik, sondern eine<br />
bestimmte Deutung der Vergangenheit wird vielfach zur wichtigen Voraussetzung neuer<br />
politischer Auseinandersetzungen und damit zu einem wichtigen Element politischer<br />
Gestaltung. » 291 Die Entscheidung für Gedenktage und die Nutzung von Gedenkanlässen<br />
fällt demnach direkt in diesen Bereich der Zeichenpolitik. In der Nation bekommt ein na-<br />
tionaler Gedenktag eine integrale Funktion, da das ihm zugrunde liegende Deutungsmus-<br />
ter in die gesellschaftliche Praxis inkorporiert wird. Demzufolge ist es konsequent, wenn<br />
<strong>Heuss</strong> frühzeitig darüber nachdenkt, eine angemessene »Form« des Gedenkens zu finden.<br />
»Will man den Staat ins Bewusstsein der Jugend als Integrationskraft geben, so muss<br />
man einen Werktag nehmen und entweder ganz oder halb schulfrei machen.« 292 Er dachte<br />
über verschiedene Gedenkanlässe nach – den 7.September als dem Datum, an dem der<br />
Bundestag das erste Mal zusammentrat oder das ambivalente aber dafür symbolisch be-<br />
deutungsvollere Datum des 8.Mai (Beschluss des Grundgesetzes, Kriegsende). 293 Aus dem<br />
Bundeskabinett kam der Vorschlag, am 3. September die Erinnerung an die Toten mit<br />
dem »Wiederentstehen des politischen Lebens« zu verbinden und am 3.September zu be-<br />
gehen. 294 Letztlich entschied man sich dafür, am 9.September 1950 eine feierliche Veran-<br />
staltung durchzuführen, auf der Bundeskanzler und Bundespräsident sprachen. Auch in<br />
den folgenden Jahren wurde das Datum des Bundestags-Zusammentritts zum Anlass für<br />
eine solche Veranstaltung genommen, wenn auch jedes Jahr die Diskussion über Termin<br />
und Zweck neu geführt wurde und das Datum nicht popularisiert wurde. Nachdem es am<br />
17. Juni 1953 in der DDR zu Unruhen kam, beschloss der Bundestag Anfang Juli 1953 auf<br />
Antrag der SPD-Fraktion und mit Unterstützung aller Parteien außer der KPD, den 17..Juni<br />
als »Tag der Einheit« zu begehen. Wenn dies auch so aussieht, als ob hier der Konsens<br />
mobilisiert wurde, der für die Durchsetzung einer breit verwurzelten gemeinsamen Ge-<br />
denkpraxis notwendig ist, so weist Wolfrum gerade das Gegenteil nach: Zwar war man<br />
sich über das Datum einig, hatte aber ziemlich gegensätzliche Vorstellungen davon,<br />
291 Steinbach (2001)<br />
292 Baumgärtner (2001); S. 174<br />
293 Morsey/Schwarz/Mensing (1997); Gespräch am 18.03.1955; S. 159<br />
294In die Entscheidungsfindung für ein Datum spielte auch hinein, dass die DDR am 12. September den<br />
Tag der Opfer des Faschismus beging (später am 10. September)<br />
101