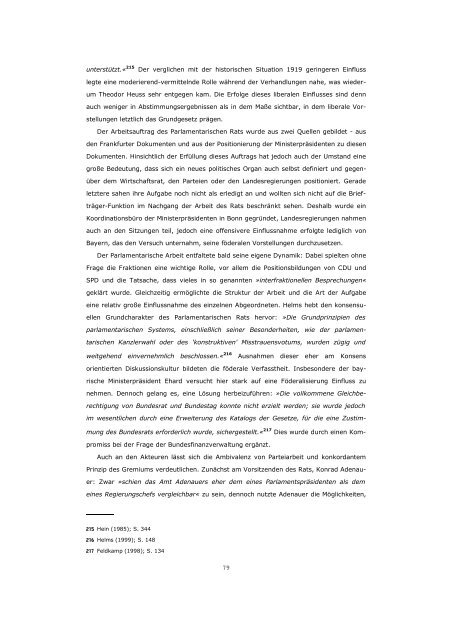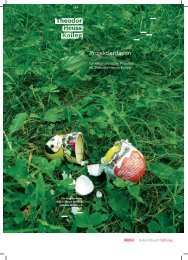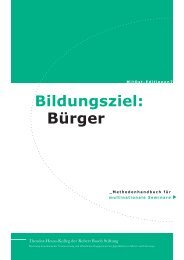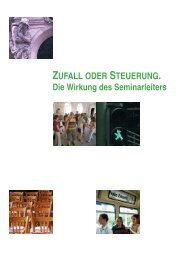pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
unterstützt.« 215 Der verglichen mit der historischen Situation 1919 geringeren Einfluss<br />
legte eine moderierend-vermittelnde Rolle während der Verhandlungen nahe, was wieder-<br />
um <strong>Theodor</strong> <strong>Heuss</strong> sehr entgegen kam. Die Erfolge dieses liberalen Einflusses sind denn<br />
auch weniger in Abstimmungsergebnissen als in dem Maße sichtbar, in dem liberale Vor-<br />
stellungen letztlich das Grundgesetz prägen.<br />
Der Arbeitsauftrag des Parlamentarischen Rats wurde aus zwei Quellen gebildet - aus<br />
den Frankfurter Dokumenten und aus der Positionierung der Ministerpräsidenten zu diesen<br />
Dokumenten. Hinsichtlich der Erfüllung dieses Auftrags hat jedoch auch der Umstand eine<br />
große Bedeutung, dass sich ein neues politisches Organ auch selbst definiert und gegen-<br />
über dem Wirtschaftsrat, den Parteien oder den Landesregierungen positioniert. Gerade<br />
letztere sahen ihre Aufgabe noch nicht als erledigt an und wollten sich nicht auf die Brief-<br />
träger-Funktion im Nachgang der Arbeit des Rats beschränkt sehen. Deshalb wurde ein<br />
Koordinationsbüro der Ministerpräsidenten in Bonn gegründet, Landesregierungen nahmen<br />
auch an den Sitzungen teil, jedoch eine offensivere Einflussnahme erfolgte lediglich von<br />
Bayern, das den Versuch unternahm, seine föderalen Vorstellungen durchzusetzen.<br />
Der Parlamentarische Arbeit entfaltete bald seine eigene Dynamik: Dabei spielten ohne<br />
Frage die Fraktionen eine wichtige Rolle, vor allem die Positionsbildungen von CDU und<br />
SPD und die Tatsache, dass vieles in so genannten »interfraktionellen Besprechungen«<br />
geklärt wurde. Gleichzeitig ermöglichte die Struktur der Arbeit und die Art der Aufgabe<br />
eine relativ große Einflussnahme des einzelnen Abgeordneten. Helms hebt den konsensu-<br />
ellen Grundcharakter des Parlamentarischen Rats hervor: »Die Grundprinzipien des<br />
parlamentarischen Systems, einschließlich seiner Besonderheiten, wie der parlamen-<br />
tarischen Kanzlerwahl oder des 'konstruktiven' Misstrauensvotums, wurden zügig und<br />
weitgehend einvernehmlich beschlossen.« 216 Ausnahmen dieser eher am Konsens<br />
orientierten Diskussionskultur bildeten die föderale Verfasstheit. Insbesondere der bay-<br />
rische Ministerpräsident Ehard versucht hier stark auf eine Föderalisierung Einfluss zu<br />
nehmen. Dennoch gelang es, eine Lösung herbeizuführen: »Die vollkommene Gleichbe-<br />
rechtigung von Bundesrat und Bundestag konnte nicht erzielt werden; sie wurde jedoch<br />
im wesentlichen durch eine Erweiterung des Katalogs der Gesetze, für die eine Zustim-<br />
mung des Bundesrats erforderlich wurde, sichergestellt.« 217 Dies wurde durch einen Kom-<br />
promiss bei der Frage der Bundesfinanzverwaltung ergänzt.<br />
Auch an den Akteuren lässt sich die Ambivalenz von Parteiarbeit und konkordantem<br />
Prinzip des Gremiums verdeutlichen. Zunächst am Vorsitzenden des Rats, Konrad Adenau-<br />
er: Zwar »schien das Amt Adenauers eher dem eines Parlamentspräsidenten als dem<br />
eines Regierungschefs vergleichbar« zu sein, dennoch nutzte Adenauer die Möglichkeiten,<br />
215 Hein (1985); S. 344<br />
216 Helms (1999); S. 148<br />
217 Feldkamp (1998); S. 134<br />
79