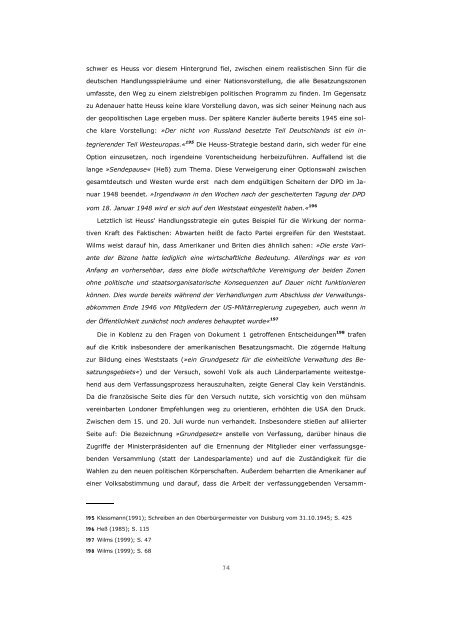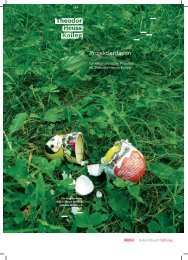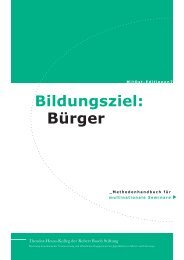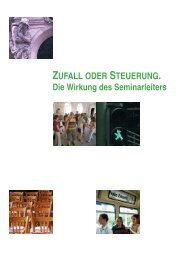pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
schwer es <strong>Heuss</strong> vor diesem Hintergrund fiel, zwischen einem realistischen Sinn für die<br />
deutschen Handlungsspielräume und einer Nationsvorstellung, die alle Besatzungszonen<br />
umfasste, den Weg zu einem zielstrebigen politischen Programm zu finden. Im Gegensatz<br />
zu Adenauer hatte <strong>Heuss</strong> keine klare Vorstellung davon, was sich seiner Meinung nach aus<br />
der geopolitischen Lage ergeben muss. Der spätere Kanzler äußerte bereits 1945 eine sol-<br />
che klare Vorstellung: »Der nicht von Russland besetzte Teil Deutschlands ist ein in-<br />
tegrierender Teil Westeuropas.« 195 Die <strong>Heuss</strong>-Strategie bestand darin, sich weder für eine<br />
Option einzusetzen, noch irgendeine Vorentscheidung herbeizuführen. Auffallend ist die<br />
lange »Sendepause« (Heß) zum Thema. Diese Verweigerung einer Optionswahl zwischen<br />
gesamtdeutsch und Westen wurde erst nach dem endgültigen Scheitern der DPD im Ja-<br />
nuar 1948 beendet. »Irgendwann in den Wochen nach der gescheiterten Tagung der DPD<br />
vom 18. Januar 1948 wird er sich auf den Weststaat eingestellt haben.« 196<br />
Letztlich ist <strong>Heuss</strong>' Handlungsstrategie ein gutes Beispiel für die Wirkung der norma-<br />
tiven Kraft des Faktischen: Abwarten heißt de facto Partei ergreifen für den Weststaat.<br />
Wilms weist darauf hin, dass Amerikaner und Briten dies ähnlich sahen: »Die erste Vari-<br />
ante der Bizone hatte lediglich eine wirtschaftliche Bedeutung. Allerdings war es von<br />
Anfang an vorhersehbar, dass eine bloße wirtschaftliche Vereinigung der beiden Zonen<br />
ohne politische und staatsorganisatorische Konsequenzen auf Dauer nicht funktionieren<br />
können. Dies wurde bereits während der Verhandlungen zum Abschluss der Verwaltungs-<br />
abkommen Ende 1946 von Mitgliedern der US-Militärregierung zugegeben, auch wenn in<br />
der Öffentlichkeit zunächst noch anderes behauptet wurde« 197<br />
Die in Koblenz zu den Fragen von Dokument 1 getroffenen Entscheidungen 198 trafen<br />
auf die Kritik insbesondere der amerikanischen Besatzungsmacht. Die zögernde Haltung<br />
zur Bildung eines Weststaats (»ein Grundgesetz für die einheitliche Verwaltung des Be-<br />
satzungsgebiets«) und der Versuch, sowohl Volk als auch Länderparlamente weitestge-<br />
hend aus dem Verfassungsprozess herauszuhalten, zeigte General Clay kein Verständnis.<br />
Da die französische Seite dies für den Versuch nutzte, sich vorsichtig von den mühsam<br />
vereinbarten Londoner Empfehlungen weg zu orientieren, erhöhten die USA den Druck.<br />
Zwischen dem 15. und 20. Juli wurde nun verhandelt. Insbesondere stießen auf alliierter<br />
Seite auf: Die Bezeichnung »Grundgesetz« anstelle von Verfassung, darüber hinaus die<br />
Zugriffe der Ministerpräsidenten auf die Ernennung der Mitglieder einer verfassungsge-<br />
benden Versammlung (statt der Landesparlamente) und auf die Zuständigkeit für die<br />
Wahlen zu den neuen politischen Körperschaften. Außerdem beharrten die Amerikaner auf<br />
einer Volksabstimmung und darauf, dass die Arbeit der verfassunggebenden Versamm-<br />
195 Klessmann(1991); Schreiben an den Oberbürgermeister von Duisburg vom 31.10.1945; S. 425<br />
196 Heß (1985); S. 115<br />
197 Wilms (1999); S. 47<br />
198 Wilms (1999); S. 68<br />
74