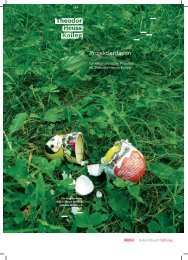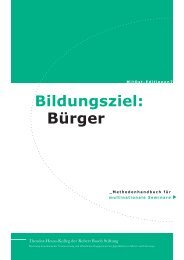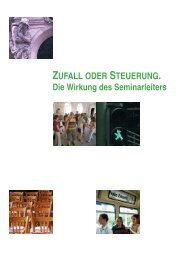pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Heuss</strong> findet einen Ausweg aus dieser Situation nicht in der sozialen Kontrolle, sondern<br />
in der verantwortungsethischen Erziehung: Die Rückbesinnung auf die eigene Menschlich-<br />
keit, das Herausbilden von Bürgersinn, Mäßigung und die Beteiligung im Ehrenamt sind<br />
die Leitwerte, die er versucht durch Kommunikation aus einer privilegierten Funktion<br />
durchzusetzen. Zudem leitet er die Autorität des eigenen Amts aus dem Glauben an diese<br />
Prinzipien ab. Die nach außen getragene Bürgerlichkeit schafft auf der einen Seite Nähe,<br />
die Demonstration seines symbolischen Kapitals schafft Würde, aber eine andere Würde<br />
als sie Hindenburgs oder Hitlers Ämter besessen haben.<br />
Wenn man dies wiederum ins Verhältnis zu den Umfragedaten setzt, sieht man, dass<br />
sich tatsächlich die Einstellung der Bürger zum politischen System ändert. Wenn bei der<br />
ersten Bundestagswahl zum Beispiel die Vorstellung von der Wahl als staatsbürgerliche<br />
Pflicht dominiert, so wird die Gelegenheit zur Pflichterfüllung bei der zweiten Wahl 1953<br />
mit einer eindrucksvollen Mehrheit für die Regierung verbunden, das politische Interesse<br />
steigt ebenso die Einschätzung der Leistung der politischen Institutionen. Damit ver-<br />
bunden eine zunehmende spezifische und diffuse Unterstützung.<br />
Das Bild wäre unvollkommen, wenn nicht erwähnt würde, dass dies mit einer deutli-<br />
chen Outputorientierung der Bürger verbunden ist: Die Unterstützung ist demnach eine<br />
Prämie für Stabilität und eine Verbesserung der Lebenssituation. Demzufolge ginge der<br />
Wandel in den Einstellungen zu einem großen Teil auf das Konto der Regierung, also in<br />
einer personalisierten Sichtweise auf den Kanzler. Das würde erklären, warum zwar Lud-<br />
wig Erhard und Konrad Adenauer als Ikonen der Gründerjahre ihren Platz im kollektiven<br />
Gedenken gefunden haben, <strong>Heuss</strong> jedoch trotz seiner damaligen Popularität heute am<br />
Rande steht.<br />
Andererseits zeigt Gabriel, dass der Wandel der politischen Kultur sowohl auf<br />
konstanten Output-Anforderungen als auch in der Zunahme der Input-Nachfrage erklärbar<br />
ist. Demzufolge ist diese Zunahme nicht allein durch positive wirtschaftliche und soziale<br />
Rahmendaten zu erklären, auch »weiche« Kategorien bekommen ihre Berechtigung.<br />
Deshalb soll an dieser Stelle über verschiedene Möglichkeiten der Bindung von Bürgern<br />
an den Staat nachgedacht werden, die von handelnden Politikern beeinflusst werden<br />
können. Eine Form der Bindung geschieht über das Teilen gemeinsamer normativer Vor-<br />
stellungen vom Politischen. Hier steht die Identifikation der Bürger mit den Vorstellungen<br />
des Politikers im Zentrum. Darüber hinaus können weitere Bindungsangebote geschaffen<br />
werden, die zwar ebenfalls personal substituiert sind, aber im Gegensatz zur Identifikation<br />
mit der Person stärker abstrakte Bindungswirkungen hervorrufen. Beispielsweise Aus-<br />
zeichnungen. Zu guter Letzt können bestimmte gesellschaftliche Gruppen dadurch an das<br />
politische System gebunden werden, dass sie eine besondere Förderung erfahren und<br />
einen besonderen informellen Zugang bekommen. Wenn dies auch nicht tieferen Ansprü-<br />
chen an eine Systematik von Vertrauensbeziehungen genügt, so soll es dennoch unserem<br />
113