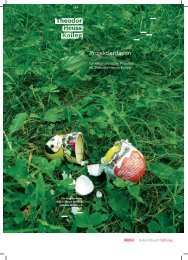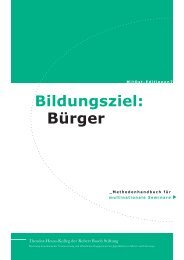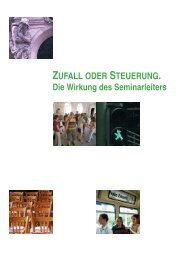pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
pdf | 1MB - Theodor-Heuss - Kolleg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
▌ Wehrpflicht, Europäische Verteidigungsgemeinschaft<br />
Eine der Angelegenheiten, in denen der Bundespräsident stark den tagespolitischen Er-<br />
eignissen ausgesetzt war, waren die Beratungen des Vertrags über die Europäische<br />
Verteidigungsgemeinschaft, die 1952 verhandelt wurden. Inhaltlich ging es bei diesem<br />
Vertragswerk um die deutsch-französische Gründung eines solchen Bündnisses und damit<br />
implizit um die Aufstellung einer Armee (oder eines deutschen »Wehrbeitrags«). Am<br />
26./27.02.1952 unterzeichnete Adenauer das Vertragswerk und die SPD-Opposition im<br />
Bundestag erhob eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht, weil sie der<br />
Meinung war, dass derartige Änderungen einer verfassungsändernden Mehrheit bedürfen<br />
und nicht der Ratifizierung mit einer absoluten Mehrheit der Bundestagsstimmen.<br />
Erschwerend kam hinzu, dass das Verhalten des Bundesrats schwer kalkulierbar war: Den<br />
Ausschlag für dessen Zustimmung hätte Baden-Württemberg geben können, das von SPD<br />
und FDP unter dem Ministerpräsidenten Reinhold Mayer regiert wurde, also von Parteien<br />
mit in dieser Frage konträren Ansichten. Mayer trat denn nun auch zur Unfreude seines<br />
ehemaligen Regierungskollegen <strong>Heuss</strong> als Adenauers föderaler Widerpart auf. Im Mai/Juni<br />
fanden nun die Lesungen des Vertragswerks vor dem Bundestag statt, gleichzeitig, am<br />
10.6.1952 die erste Verhandlung im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, vor dem so<br />
genannten »roten« ersten Senat (der tendenziell der SPD zugeneigt war, während der<br />
zweite Senat tendenziell eher den Auffassungen von CDU/CSU entsprach). Vor dieser Si-<br />
tuation erbat <strong>Heuss</strong> am gleichen Tag ein Rechtsgutachten, das die Frage klären sollte, ob<br />
der Vertrag mit Bezug auf Artikel 24 des Grundgesetzes (Übertragung von Hoheitsrech-<br />
ten) verfassungskonform sei. Dieses Gutachten sollte auf der einen Seite den Präsidenten<br />
für sein Verhalten nach der erfolgten Zustimmung beraten und auf der anderen Seite die<br />
Lesung des Vertragswerks im Bundestag von den juristischen Erörterungen befreien, die<br />
eine politische Entscheidung zu überlagern drohten. 246 Eine dritte Motivation bestand dar-<br />
in, über ein positives Gutachten Bedenken in Bundestag und Bundesrat zu zerstreuen und<br />
so auf eine Entscheidung im Sinne der Regierungsmeinung einzuwirken. Auch Adenauer<br />
stützt diese Sicht auf die Dinge in seinen Memoiren: Demnach sei <strong>Heuss</strong> »nicht ganz<br />
überzeugt [gewesen], ob der Vertrag mit dem Grundgesetz zu vereinbaren sei.« 247 Dies<br />
kann aber schon deshalb nicht stimmen, weil das Gutachten auf Wunsch der Bundesre-<br />
gierung vom Präsidenten veranlasst wurde. Unter anderem liefert das Protokoll einer Vier-<br />
Augen-Besprechung zwischen Adenauer und <strong>Heuss</strong> am 3. März 1952 einen deutlichen Hin-<br />
weis darauf, dass die Idee des Gutachtens auch einem sachpolitischen Kalkül von <strong>Heuss</strong><br />
entspringt: »Der Bundespräsident erzählte dem Bundeskanzler, dass der Gedanke ihn be-<br />
wegt habe, zur Beschleunigung der Entscheidung eventuell ein Gutachten zu erbitten.« 248<br />
246Pikart (76); S. 105<br />
247 Sternberger (1990); S. 117<br />
248 Morsey/Schwarz/Mensing (1997); Besprechung am 03.05.1952; S. 83<br />
89