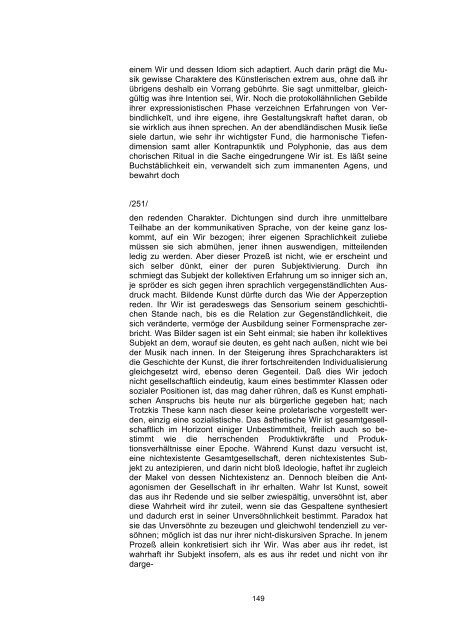Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
einem Wir und dessen Idiom sich adaptiert. Auch darin prägt die Musik<br />
gewisse Charaktere des Künstlerischen extrem aus, ohne daß ihr<br />
übrigens deshalb ein Vorrang gebührte. Sie sagt unmittelbar, gleichgültig<br />
was ihre Intention sei, Wir. Noch die protokollähnlichen Gebilde<br />
ihrer expressionistischen Phase verzeichnen Erfahrungen von Verbindlichkeīt,<br />
und ihre eigene, ihre Gestaltungskraft haftet daran, ob<br />
sie wirklich aus ihnen sprechen. An der abendländischen Musik ließe<br />
siele dartun, wie sehr ihr wichtigster Fund, die harmonische Tiefendimension<br />
samt aller Kontrapunktik und Polyphonie, das aus dem<br />
chorischen Ritual in die Sache eingedrungene Wir ist. Es läßt seine<br />
Buchstäblichkeit ein, verwandelt sich zum immanenten Agens, und<br />
bewahrt doch<br />
/251/<br />
den redenden Charakter. Dichtungen sind durch ihre unmittelbare<br />
Teilhabe an der kommunikativen Sprache, von der keine ganz loskommt,<br />
auf ein Wir bezogen; ihrer eigenen Sprachlichkeit zuliebe<br />
müssen sie sich abmühen, jener ihnen auswendigen, mitteilenden<br />
ledig zu werden. Aber dieser Prozeß ist nicht, wie er erscheint und<br />
sich selber dünkt, einer der puren Subjektivierung. Durch ihn<br />
schmiegt das Subjekt der kollektiven Erfahrung um so inniger sich an,<br />
je spröder es sich gegen ihren sprachlich vergegenständlichten Ausdruck<br />
macht. Bildende Kunst dürfte durch das Wie der Apperzeption<br />
reden. Ihr Wir ist geradeswegs das Sensorium seinem geschichtlichen<br />
Stande nach, bis es die Relation zur Gegenständlichkeit, die<br />
sich veränderte, vermöge der Ausbildung seiner Formensprache zerbricht.<br />
Was Bilder sagen ist ein Seht einmal; sie haben ihr kollektives<br />
Subjekt an dem, worauf sie deuten, es geht nach außen, nicht wie bei<br />
der Musik nach innen. In der Steigerung ihres Sprachcharakters ist<br />
die Geschichte der Kunst, die ihrer fortschreitenden Individualisierung<br />
gleichgesetzt wird, ebenso deren Gegenteil. Daß dies Wir jedoch<br />
nicht gesellschaftlich eindeutig, kaum eines bestimmter Klassen oder<br />
sozialer Positionen ist, das mag daher rühren, daß es Kunst emphatischen<br />
Anspruchs bis heute nur als bürgerliche gegeben hat; nach<br />
Trotzkis These kann nach dieser keine proletarische vorgestellt werden,<br />
einzig eine sozialistische. Das ästhetische Wir ist gesamtgesellschaftlich<br />
im Horizont einiger Unbestimmtheit, freilich auch so bestimmt<br />
wie die herrschenden Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse<br />
einer Epoche. Während Kunst dazu versucht ist,<br />
eine nichtexistente Gesamtgesellschaft, deren nichtexistentes Subjekt<br />
zu antezipieren, und darin nicht bloß Ideologie, haftet ihr zugleich<br />
der Makel von dessen Nichtexistenz an. Dennoch bleiben die Antagonismen<br />
der Gesellschaft in ihr erhalten. Wahr Ist Kunst, soweit<br />
das aus ihr Redende und sie selber zwiespältig, unversöhnt ist, aber<br />
diese Wahrheit wird ihr zuteil, wenn sie das Gespaltene synthesiert<br />
und dadurch erst in seiner Unversöhnlichkeit bestimmt. Paradox hat<br />
sie das Unversöhnte zu bezeugen und gleichwohl tendenziell zu versöhnen;<br />
möglich ist das nur ihrer nicht-diskursiven Sprache. In jenem<br />
Prozeß allein konkretisiert sich ihr Wir. Was aber aus ihr redet, ist<br />
wahrhaft ihr Subjekt insofern, als es aus ihr redet und nicht von ihr<br />
darge-<br />
149