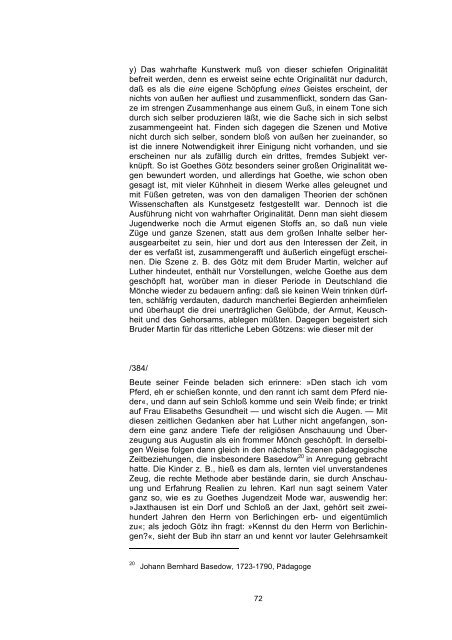Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
y) Das wahrhafte Kunstwerk muß von dieser schiefen Originalität<br />
befreit werden, denn es erweist seine echte Originalität nur dadurch,<br />
daß es als die eine eigene Schöpfung eines Geistes erscheint, der<br />
nichts von außen her aufliest und zusammenflickt, sondern das Ganze<br />
im strengen Zusammenhange aus einem Guß, in einem Tone sich<br />
durch sich selber produzieren läßt, wie die Sache sich in sich selbst<br />
zusammengeeint hat. Finden sich dagegen die Szenen und Motive<br />
nicht durch sich selber, sondern bloß von außen her zueinander, so<br />
ist die innere Notwendigkeit ihrer Einigung nicht vorhanden, und sie<br />
erscheinen nur als zufällig durch ein drittes, fremdes Subjekt verknüpft.<br />
So ist Goethes Götz besonders seiner großen Originalität wegen<br />
bewundert worden, und allerdings hat Goethe, wie schon oben<br />
gesagt ist, mit vieler Kühnheit in diesem Werke alles geleugnet und<br />
mit Füßen getreten, was von den damaligen Theorien der schönen<br />
Wissenschaften als Kunstgesetz festgestellt war. Dennoch ist die<br />
Ausführung nicht von wahrhafter Originalität. Denn man sieht diesem<br />
Jugendwerke noch die Armut eigenen Stoffs an, so daß nun viele<br />
Züge und ganze Szenen, statt aus dem großen Inhalte selber herausgearbeitet<br />
zu sein, hier und dort aus den Interessen der Zeit, in<br />
der es verfaßt ist, zusammengerafft und äußerlich eingefügt erscheinen.<br />
Die Szene z. B. des Götz mit dem Bruder Martin, welcher auf<br />
Luther hindeutet, enthält nur Vorstellungen, welche Goethe aus dem<br />
geschöpft hat, worüber man in dieser Periode in Deutschland die<br />
Mönche wieder zu bedauern anfing: daß sie keinen Wein trinken dürften,<br />
schläfrig verdauten, dadurch mancherlei Begierden anheimfielen<br />
und überhaupt die drei unerträglichen Gelübde, der Armut, Keuschheit<br />
und des Gehorsams, ablegen müßten. Dagegen begeistert sich<br />
Bruder Martin für das ritterliche Leben Götzens: wie dieser mit der<br />
/384/<br />
Beute seiner Feinde beladen sich erinnere: »Den stach ich vom<br />
Pferd, eh er schießen konnte, und den rannt ich samt dem Pferd nieder«,<br />
und dann auf sein Schloß komme und sein Weib finde; er trinkt<br />
auf Frau Elisabeths Gesundheit — und wischt sich die Augen. — Mit<br />
diesen zeitlichen Gedanken aber hat Luther nicht angefangen, sondern<br />
eine ganz andere Tiefe der religiösen Anschauung und Überzeugung<br />
aus Augustin als ein frommer Mönch geschöpft. In derselbigen<br />
Weise folgen dann gleich in den nächsten Szenen pädagogische<br />
Zeitbeziehungen, die insbesondere Basedow 20 in Anregung gebracht<br />
hatte. Die Kinder z. B., hieß es dam als, lernten viel unverstandenes<br />
Zeug, die rechte Methode aber bestände darin, sie durch Anschauung<br />
und Erfahrung Realien zu lehren. Karl nun sagt seinem Vater<br />
ganz so, wie es zu Goethes Jugendzeit Mode war, auswendig her:<br />
»Jaxthausen ist ein Dorf und Schloß an der Jaxt, gehört seit zweihundert<br />
Jahren den Herrn von Berlichingen erb- und eigentümlich<br />
zu«; als jedoch Götz ihn fragt: »Kennst du den Herrn von Berlichingen?«,<br />
sieht der Bub ihn starr an und kennt vor lauter Gelehrsamkeit<br />
20 Johann Bernhard Basedow, 1723-1790, Pädagoge<br />
72