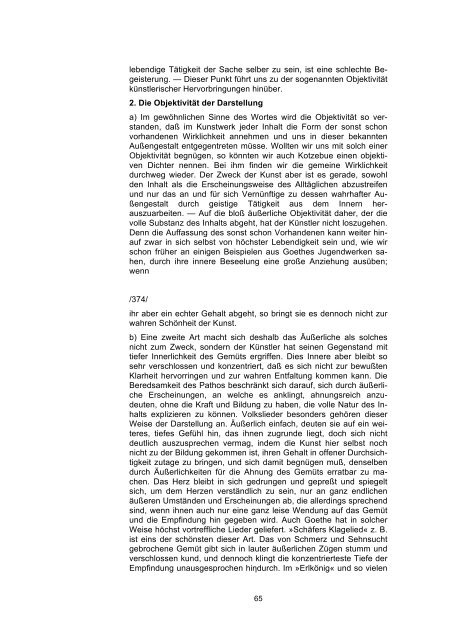Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
lebendige Tätigkeit der Sache selber zu sein, ist eine schlechte Begeisterung.<br />
— Dieser Punkt führt uns zu der sogenannten Objektivität<br />
künstlerischer Hervorbringungen hinüber.<br />
2. Die Objektivität der Darstellung<br />
a) Im gewöhnlichen Sinne des Wortes wird die Objektivität so verstanden,<br />
daß im Kunstwerk jeder Inhalt die Form der sonst schon<br />
vorhandenen Wirklichkeit annehmen und uns in dieser bekannten<br />
Außengestalt entgegentreten müsse. Wollten wir uns mit solch einer<br />
Objektivität begnügen, so könnten wir auch Kotzebue einen objektiven<br />
Dichter nennen. Bei ihm finden wir die gemeine Wirklichkeit<br />
durchweg wieder. Der Zweck der Kunst aber ist es gerade, sowohl<br />
den Inhalt als die Erscheinungsweise des Alltäglichen abzustreifen<br />
und nur das an und für sich Vernünftige zu dessen wahrhafter Außengestalt<br />
durch geistige Tätigkeit aus dem Innern herauszuarbeiten.<br />
— Auf die bloß äußerliche Objektivität daher, der die<br />
volle Substanz des Inhalts abgeht, hat der Künstler nicht loszugehen.<br />
Denn die Auffassung des sonst schon Vorhandenen kann weiter hinauf<br />
zwar in sich selbst von höchster Lebendigkeit sein und, wie wir<br />
schon früher an einigen Beispielen aus Goethes Jugendwerken sahen,<br />
durch ihre innere Beseelung eine große Anziehung ausüben;<br />
wenn<br />
/374/<br />
ihr aber ein echter Gehalt abgeht, so bringt sie es dennoch nicht zur<br />
wahren Schönheit der Kunst.<br />
b) Eine zweite Art macht sich deshalb das Äußerliche als solches<br />
nicht zum Zweck, sondern der Künstler hat seinen Gegenstand mit<br />
tiefer Innerlichkeit des Gemüts ergriffen. Dies Innere aber bleibt so<br />
sehr verschlossen und konzentriert, daß es sich nicht zur bewußten<br />
Klarheit hervorringen und zur wahren Entfaltung kommen kann. Die<br />
Beredsamkeit des Pathos beschränkt sich darauf, sich durch äußerliche<br />
Erscheinungen, an welche es anklingt, ahnungsreich anzudeuten,<br />
ohne die Kraft und Bildung zu haben, die volle Natur des Inhalts<br />
explizieren zu können. Volkslieder besonders gehören dieser<br />
Weise der Darstellung an. Äußerlich einfach, deuten sie auf ein weiteres,<br />
tiefes Gefühl hin, das ihnen zugrunde liegt, doch sich nicht<br />
deutlich auszusprechen vermag, indem die Kunst hier selbst noch<br />
nicht zu der Bildung gekommen ist, ihren Gehalt in offener Durchsichtigkeit<br />
zutage zu bringen, und sich damit begnügen muß, denselben<br />
durch Äußerlichkeiten für die Ahnung des Gemüts erratbar zu machen.<br />
Das Herz bleibt in sich gedrungen und gepreßt und spiegelt<br />
sich, um dem Herzen verständlich zu sein, nur an ganz endlichen<br />
äußeren Umständen und Erscheinungen ab, die allerdings sprechend<br />
sind, wenn ihnen auch nur eine ganz leise Wendung auf das Gemüt<br />
und die Empfindung hin gegeben wird. Auch Goethe hat in solcher<br />
Weise höchst vortreffliche Lieder geliefert. »Schäfers Klagelied« z. B.<br />
ist eins der schönsten dieser Art. Das von Schmerz und Sehnsucht<br />
gebrochene Gemüt gibt sich in lauter äußerlichen Zügen stumm und<br />
verschlossen kund, und dennoch klingt die konzentrierteste Tiefe der<br />
Empfindung unausgesprochen hiηdurch. Im »Erlkönig« und so vielen<br />
65