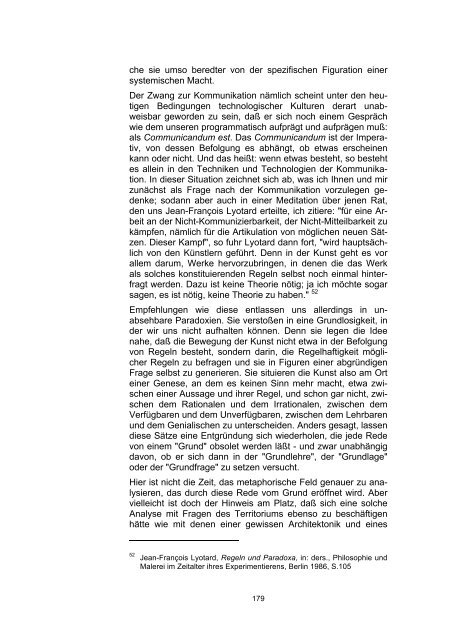Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
che sie umso beredter von der spezifischen Figuration einer<br />
systemischen Macht.<br />
Der Zwang zur Kommunikation nämlich scheint unter den heutigen<br />
Bedingungen technologischer Kulturen derart unabweisbar<br />
geworden zu sein, daß er sich noch einem Gespräch<br />
wie dem unseren programmatisch aufprägt und aufprägen muß:<br />
als Communicandum est. Das Communicandum ist der Imperativ,<br />
von dessen Befolgung es abhängt, ob etwas erscheinen<br />
kann oder nicht. Und das heißt: wenn etwas besteht, so besteht<br />
es allein in den Techniken und Technologien der Kommunikation.<br />
In dieser Situation zeichnet sich ab, was ich Ihnen und mir<br />
zunächst als Frage nach der Kommunikation vorzulegen gedenke;<br />
sodann aber auch in einer Meditation über jenen Rat,<br />
den uns Jean-François Lyotard erteilte, ich zitiere: "für eine Arbeit<br />
an der Nicht-Kommunizierbarkeit, der Nicht-Mitteilbarkeit zu<br />
kämpfen, nämlich für die Artikulation von möglichen neuen Sätzen.<br />
Dieser Kampf", so fuhr Lyotard dann fort, "wird hauptsächlich<br />
von den Künstlern geführt. Denn in der Kunst geht es vor<br />
allem darum, Werke hervorzubringen, in denen die das Werk<br />
als solches konstituierenden Regeln selbst noch einmal hinterfragt<br />
werden. Dazu ist keine Theorie nötig; ja ich möchte sogar<br />
sagen, es ist nötig, keine Theorie zu haben." 52<br />
Empfehlungen wie diese entlassen uns allerdings in unabsehbare<br />
Paradoxien. Sie verstoßen in eine Grundlosigkeit, in<br />
der wir uns nicht aufhalten können. Denn sie legen die Idee<br />
nahe, daß die Bewegung der Kunst nicht etwa in der Befolgung<br />
von Regeln besteht, sondern darin, die Regelhaftigkeit möglicher<br />
Regeln zu befragen und sie in Figuren einer abgründigen<br />
Frage selbst zu generieren. Sie situieren die Kunst also am Ort<br />
einer Genese, an dem es keinen Sinn mehr macht, etwa zwischen<br />
einer Aussage und ihrer Regel, und schon gar nicht, zwischen<br />
dem Rationalen und dem Irrationalen, zwischen dem<br />
Verfügbaren und dem Unverfügbaren, zwischen dem Lehrbaren<br />
und dem Genialischen zu unterscheiden. Anders gesagt, lassen<br />
diese Sätze eine Entgründung sich wiederholen, die jede Rede<br />
von einem "Grund" obsolet werden läßt - und zwar unabhängig<br />
davon, ob er sich dann in der "Grundlehre", der "Grundlage"<br />
oder der "Grundfrage" zu setzen versucht.<br />
Hier ist nicht die Zeit, das metaphorische Feld genauer zu analysieren,<br />
das durch diese Rede vom Grund eröffnet wird. Aber<br />
vielleicht ist doch der Hinweis am Platz, daß sich eine solche<br />
Analyse mit Fragen des Territoriums ebenso zu beschäftigen<br />
hätte wie mit denen einer gewissen Architektonik und eines<br />
52 Jean-François Lyotard, Regeln und Paradoxa, in: ders., Philosophie und<br />
Malerei im Zeitalter ihres Experimentierens, Berlin 1986, S.105<br />
179