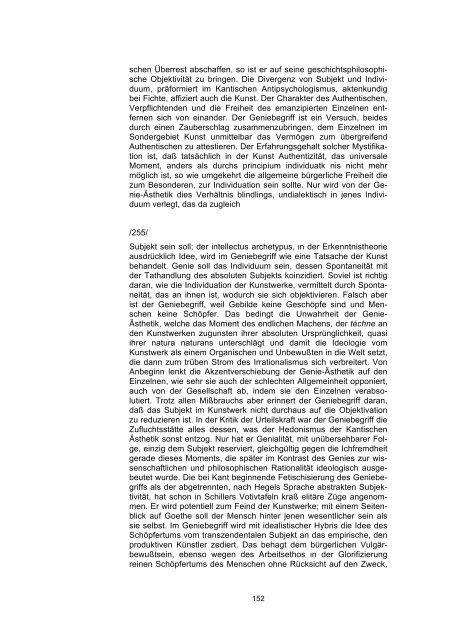Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
schen Überrest abschaffen, so ist er auf seine geschichtsphilosophische<br />
Objektivität zu bringen. Die Divergenz von Subjekt und Individuum,<br />
präformiert im Kantischen Antipsychologismus, aktenkundig<br />
bei Fichte, affiziert auch die Kunst. Der Charakter des Authentischen,<br />
Verpflichtenden und die Freiheit des emanzipierten Einzelnen entfernen<br />
sich von einander. Der Geniebegriff ist ein Versuch, beides<br />
durch einen Zauberschlag zusammenzubringen, dem Einzelnen im<br />
Sondergebiet Kunst unmittelbar das Vermögen zum übergreifend<br />
Authentischen zu attestieren. Der Erfahrungsgehalt solcher Mystifikation<br />
ist, daß tatsächlich in der Kunst Authentizität, das universale<br />
Moment, anders als durchs principium individuatk nis nicht mehr<br />
möglich ist, so wie umgekehrt die allgemeine bürgerliche Freiheit die<br />
zum Besonderen, zur Individuation sein sollte. Nur wird von der Genie-Ästhetik<br />
dies Verhältnis blindlings, undialektisch in jenes Individuum<br />
verlegt, das da zugleich<br />
/255/<br />
Subjekt sein soll; der intellectus archetypus, ιn der Erkenntnistheorie<br />
ausdrücklich Idee, wird im Geniebegriff wie eine Tatsache der Kunst<br />
behandelt. Genie soll das Individuum sein, dessen Spontaneität mit<br />
der Tathandlung des absoluten Subjekts koinzidiert. Soviel ist richtig<br />
daran, wie die Individuation der Kunstwerke, vermittelt durch Spontaneität,<br />
das an ihnen ist, wodurch sie sich objektivieren. Falsch aber<br />
ist der Geniebegriff, weil Gebilde keine Geschöpfe sind und Menschen<br />
keine Schöpfer. Das bedingt die Unwahrheit der Genie-<br />
Ästhetik, welche das Moment des endlichen Machens, der téchne an<br />
den Kunstwerken zugunsten ihrer absoluten Ursprünglichkeit, quasi<br />
ihrer natura naturans unterschlägt und damit die Ideologie vom<br />
Kunstwerk als einem Organischen und Unbewußten in die Welt setzt,<br />
die dann zum trüben Strom des Irrationalismus sich verbreitert. Von<br />
Anbeginn lenkt die Akzentverschiebung der Genie-Ästhetik auf den<br />
Einzelnen, wie sehr sie auch der schlechten Allgemeinheit opponiert,<br />
auch von der Gesellschaft ab, indem sie den Einzelnen verabsolutiert.<br />
Trotz allen Mißbrauchs aber erinnert der Geniebegriff daran,<br />
daß das Subjekt im Kunstwerk nicht durchaus auf die Objektivation<br />
zu reduzieren ist. In der Kritik der Urteilskraft war der Geniebegriff die<br />
Zufluchtsstätte alles dessen, was der Hedonismus der Kantischen<br />
Ästhetik sonst entzog. Nur hat er Genialität, mit unübersehbarer Folge,<br />
einzig dem Subjekt reserviert, gleichgültig gegen die Ichfremdheit<br />
gerade dieses Moments, die später im Kontrast des Genies zur wissenschaftlichen<br />
und philosophischen Rationalität ideologisch ausgebeutet<br />
wurde. Die bei Kant beginnende Fetischisierung des Geniebegriffs<br />
als der abgetrennten, nach Hegels Sprache abstrakten Subjektivität,<br />
hat schon in Schillers Votivtafeln kraß elitäre Züge angenommen.<br />
Er wird potentiell zum Feind der Kunstwerke; mit einem Seitenblick<br />
auf Goethe soll der Mensch hinter jenen wesentlicher sein als<br />
sie selbst. Im Geniebegriff wird mit idealistischer Hybris die Idee des<br />
Schöpfertums vom transzendentalen Subjekt an das empirische, den<br />
produktiven Künstler zediert. Das behagt dem bürgerlichen Vulgärbewußtsein,<br />
ebenso wegen des Arbeitsethos ιn der Glorifizierung<br />
reinen Schöpfertums des Menschen ohne Rücksicht auf den Zweck,<br />
152