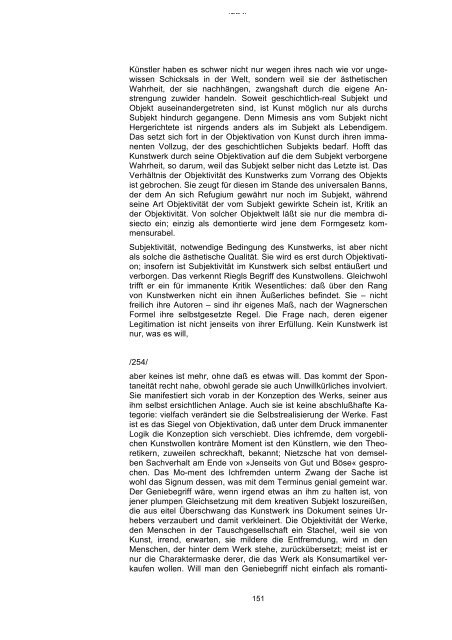Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Geniebegriffe - Hans-Joachim Lenger
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Künstler haben es schwer nicht nur wegen ihres nach wie vor ungewissen<br />
Schicksals in der Welt, sondern weil sie der ästhetischen<br />
Wahrheit, der sie nachhängen, zwangshaft durch die eigene Anstrengung<br />
zuwider handeln. Soweit geschichtlich-real Subjekt und<br />
Objekt auseinandergetreten sind, ist Kunst möglich nur als durchs<br />
Subjekt hindurch gegangene. Denn Mimesis ans vom Subjekt nicht<br />
Hergerichtete ist nirgends anders als im Subjekt als Lebendigem.<br />
Das setzt sich fort in der Objektivation von Kunst durch ihren immanenten<br />
Vollzug, der des geschichtlichen Subjekts bedarf. Hofft das<br />
Kunstwerk durch seine Objektivation auf die dem Subjekt verborgene<br />
Wahrheit, so darum, weil das Subjekt selber nicht das Letzte ist. Das<br />
Verhältnis der Objektivität des Kunstwerks zum Vorrang des Objekts<br />
ist gebrochen. Sie zeugt für diesen im Stande des universalen Banns,<br />
der dem An sich Refugium gewährt nur noch im Subjekt, während<br />
seine Art Objektivität der vom Subjekt gewirkte Schein ist, Kritik an<br />
der Objektivität. Von solcher Objektwelt läßt sie nur die membra disiecto<br />
ein; einzig als demontierte wird jene dem Formgesetz kommensurabel.<br />
Subjektivität, notwendige Bedingung des Kunstwerks, ist aber nicht<br />
als solche die ästhetische Qualität. Sie wird es erst durch Objektivation;<br />
insofern ist Subjektivität im Kunstwerk sich selbst entäußert und<br />
verborgen. Das verkennt Riegls Begriff des Kunstwollens. Gleichwohl<br />
trifft er ein für immanente Kritik Wesentliches: daß über den Rang<br />
von Kunstwerken nicht ein ihnen Äußerliches befindet. Sie – nicht<br />
freilich ihre Autoren – sind ihr eigenes Maß, nach der Wagnerschen<br />
Formel ihre selbstgesetzte Regel. Die Frage nach, deren eigener<br />
Legitimation ist nicht jenseits von ihrer Erfüllung. Kein Kunstwerk ist<br />
nur, was es will,<br />
/254/<br />
/254/<br />
aber keines ist mehr, ohne daß es etwas will. Das kommt der Spontaneität<br />
recht nahe, obwohl gerade sie auch Unwillkürliches involviert.<br />
Sie manifestiert sich vorab in der Konzeption des Werks, seiner aus<br />
ihm selbst ersichtlichen Anlage. Auch sie ist keine abschlußhafte Kategorie:<br />
vielfach verändert sie die Selbstrealisierung der Werke. Fast<br />
ist es das Siegel von Objektivation, daß unter dem Druck immanenter<br />
Logik die Konzeption sich verschiebt. Dies ichfremde, dem vorgeblichen<br />
Kunstwollen konträre Moment ist den Künstlern, wie den Theoretikern,<br />
zuweilen schreckhaft, bekannt; Nietzsche hat von demselben<br />
Sachverhalt am Ende von »Jenseits von Gut und Böse« gesprochen.<br />
Das Mo-ment des Ichfremden unterm Zwang der Sache ist<br />
wohl das Signum dessen, was mit dem Terminus genial gemeint war.<br />
Der Geniebegriff wäre, wenn irgend etwas an ihm zu halten ist, von<br />
jener plumpen Gleichsetzung mit dem kreativen Subjekt loszureißen,<br />
die aus eitel Überschwang das Kunstwerk ins Dokument seines Urhebers<br />
verzaubert und damit verkleinert. Die Objektivität der Werke,<br />
den Menschen in der Tauschgesellschaft ein Stachel, weil sie von<br />
Kunst, irrend, erwarten, sie mildere die Entfremdung, wird ιn den<br />
Menschen, der hinter dem Werk stehe, zurückübersetzt; meist ist er<br />
nur die Charaktermaske derer, die das Werk als Konsumartikel verkaufen<br />
wollen. Will man den Geniebegriff nicht einfach als romanti-<br />
151