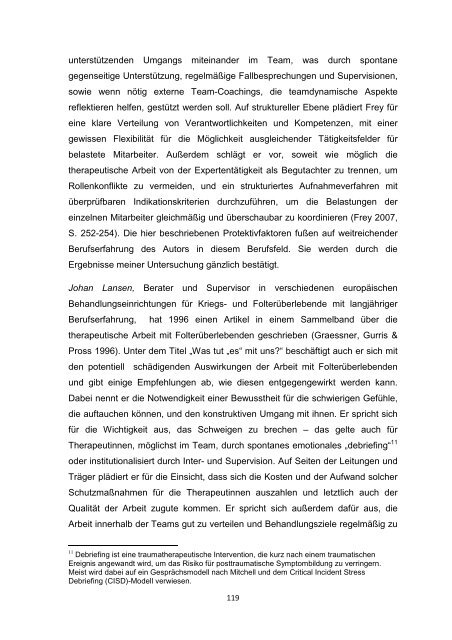Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
unterstützenden Umgangs miteinander im Team, was durch spontane<br />
<strong>gegen</strong>seitige Unterstützung, regelmäßige Fallbesprechungen und Supervisionen,<br />
sowie wenn nötig externe Team-Coachings, die teamdynamische Aspekte<br />
reflektieren helfen, gestützt werden soll. Auf struktureller Ebene plädiert Frey <strong>für</strong><br />
eine klare Verteilung von Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, mit einer<br />
gewissen Flexibilität <strong>für</strong> die Möglichkeit ausgleichender Tätigkeitsfelder <strong>für</strong><br />
belastete Mitarbeiter. Außerdem schlägt er vor, soweit wie möglich die<br />
therapeutische Arbeit von der Expertentätigkeit als Begutachter zu trennen, um<br />
Rollenkonflikte zu vermeiden, und ein strukturiertes Aufnahmeverfahren mit<br />
überprüfbaren Indikationskriterien durchzuführen, um die Belastungen der<br />
einzelnen Mitarbeiter gleichmäßig und überschaubar zu koordinieren (Frey 2007,<br />
S. 252-254). Die hier beschriebenen Protektivfaktoren fußen auf weitreichender<br />
Berufserfahrung des Autors in diesem Berufsfeld. Sie werden durch die<br />
Ergebnisse meiner Untersuchung gänzlich bestätigt.<br />
Johan Lansen, Berater und Supervisor in verschiedenen europäischen<br />
Behandlungseinrichtungen <strong>für</strong> Kriegs- und Folterüberlebende mit langjähriger<br />
Berufserfahrung, hat 1996 einen Artikel in einem Sammelband über die<br />
therapeutische Arbeit mit Folterüberlebenden geschrieben (Graessner, Gurris &<br />
Pross 1996). Unter dem Titel „Was tut „es“ mit uns?“ beschäftigt auch er sich mit<br />
den potentiell schädigenden Auswirkungen der Arbeit mit Folterüberlebenden<br />
und gibt einige Empfehlungen ab, wie diesen ent<strong>gegen</strong>gewirkt werden kann.<br />
Dabei nennt er die Notwendigkeit einer Bewusstheit <strong>für</strong> die schwierigen Gefühle,<br />
die auftauchen können, und den konstruktiven Umgang mit ihnen. Er spricht sich<br />
<strong>für</strong> die Wichtigkeit aus, das Schweigen zu brechen – das gelte auch <strong>für</strong><br />
Therapeutinnen, möglichst im Team, durch spontanes emotionales „debriefing“ 11<br />
oder institutionalisiert durch Inter- und Supervision. Auf Seiten der Leitungen und<br />
Träger plädiert er <strong>für</strong> die Einsicht, dass sich die Kosten und der Aufwand solcher<br />
Schutzmaßnahmen <strong>für</strong> die Therapeutinnen auszahlen und letztlich auch der<br />
Qualität der Arbeit zugute kommen. Er spricht sich außerdem da<strong>für</strong> aus, die<br />
Arbeit innerhalb der Teams gut zu verteilen und Behandlungsziele regelmäßig zu<br />
11 Debriefing ist eine traumatherapeutische Intervention, die kurz nach einem traumatischen<br />
Ereignis angewandt wird, um das Risiko <strong>für</strong> posttraumatische Symptombildung zu verringern.<br />
Meist wird dabei auf ein Gesprächsmodell nach Mitchell und dem Critical Incident Stress<br />
Debriefing (CISD)-Modell verwiesen.<br />
119