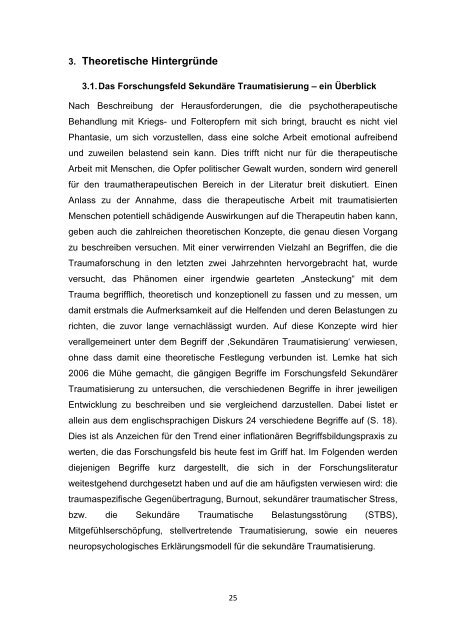Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3. Theoretische Hintergründe<br />
3.1. Das Forschungsfeld <strong>Sekundäre</strong> <strong>Traumatisierung</strong> – ein Überblick<br />
Nach Beschreibung der Herausforderungen, die die psychotherapeutische<br />
Behandlung mit Kriegs- und Folteropfern mit sich bringt, braucht es nicht viel<br />
Phantasie, um sich vorzustellen, dass eine solche Arbeit emotional aufreibend<br />
und zuweilen belastend sein kann. Dies trifft nicht nur <strong>für</strong> die therapeutische<br />
Arbeit mit Menschen, die Opfer politischer Gewalt wurden, sondern wird generell<br />
<strong>für</strong> den traumatherapeutischen Bereich in der Literatur breit diskutiert. Einen<br />
Anlass zu der Annahme, dass die therapeutische Arbeit mit traumatisierten<br />
Menschen potentiell schädigende Auswirkungen auf die Therapeutin haben kann,<br />
geben auch die zahlreichen theoretischen Konzepte, die genau diesen Vorgang<br />
zu beschreiben versuchen. Mit einer verwirrenden Vielzahl an Begriffen, die die<br />
Traumaforschung in den letzten zwei Jahrzehnten hervorgebracht hat, wurde<br />
versucht, das Phänomen einer irgendwie gearteten „Ansteckung“ mit dem<br />
Trauma begrifflich, theoretisch und konzeptionell zu fassen und zu messen, um<br />
damit erstmals die Aufmerksamkeit auf die Helfenden und deren Belastungen zu<br />
richten, die zuvor lange vernachlässigt wurden. Auf diese Konzepte wird hier<br />
verallgemeinert unter dem Begriff der ‚<strong>Sekundäre</strong>n <strong>Traumatisierung</strong>‘ verwiesen,<br />
ohne dass damit eine theoretische Festlegung verbunden ist. Lemke hat sich<br />
2006 die Mühe gemacht, die gängigen Begriffe im Forschungsfeld <strong>Sekundäre</strong>r<br />
<strong>Traumatisierung</strong> zu untersuchen, die verschiedenen Begriffe in ihrer jeweiligen<br />
Entwicklung zu beschreiben und sie vergleichend darzustellen. Dabei listet er<br />
allein aus dem englischsprachigen Diskurs 24 verschiedene Begriffe auf (S. 18).<br />
Dies ist als Anzeichen <strong>für</strong> den Trend einer inflationären Begriffsbildungspraxis zu<br />
werten, die das Forschungsfeld bis heute fest im Griff hat. Im Folgenden werden<br />
diejenigen Begriffe kurz dargestellt, die sich in der Forschungsliteratur<br />
weitestgehend durchgesetzt haben und auf die am häufigsten verwiesen wird: die<br />
traumaspezifische Gegenübertragung, Burnout, sekundärer traumatischer Stress,<br />
bzw. die <strong>Sekundäre</strong> Traumatische Belastungsstörung (STBS),<br />
Mitgefühlserschöpfung, stellvertretende <strong>Traumatisierung</strong>, sowie ein neueres<br />
neuropsychologisches Erklärungsmodell <strong>für</strong> die sekundäre <strong>Traumatisierung</strong>.<br />
25