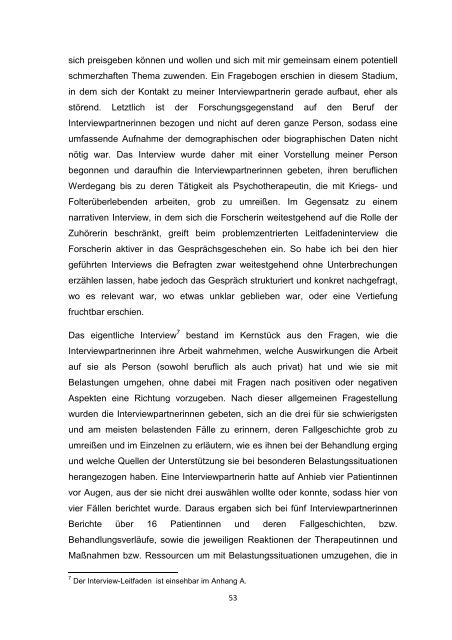Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sich preisgeben können und wollen und sich mit mir gemeinsam einem potentiell<br />
schmerzhaften Thema zuwenden. Ein Fragebogen erschien in diesem Stadium,<br />
in dem sich der Kontakt zu meiner Interviewpartnerin gerade aufbaut, eher als<br />
störend. Letztlich ist der Forschungs<strong>gegen</strong>stand auf den Beruf der<br />
Interviewpartnerinnen bezogen und nicht auf deren ganze Person, sodass eine<br />
umfassende Aufnahme der demographischen oder biographischen Daten nicht<br />
nötig war. Das Interview wurde daher mit einer Vorstellung meiner Person<br />
begonnen und daraufhin die Interviewpartnerinnen gebeten, ihren beruflichen<br />
Werdegang bis zu deren Tätigkeit als Psychotherapeutin, die mit Kriegs- und<br />
Folterüberlebenden arbeiten, grob zu umreißen. Im Gegensatz zu einem<br />
narrativen Interview, in dem sich die Forscherin weitestgehend auf die Rolle der<br />
Zuhörerin beschränkt, greift beim problemzentrierten Leitfadeninterview die<br />
Forscherin aktiver in das Gesprächsgeschehen ein. So habe ich bei den hier<br />
geführten Interviews die Befragten zwar weitestgehend ohne Unterbrechungen<br />
erzählen lassen, habe jedoch das Gespräch strukturiert und konkret nachgefragt,<br />
wo es relevant war, wo etwas unklar geblieben war, oder eine Vertiefung<br />
fruchtbar erschien.<br />
Das eigentliche Interview 7 bestand im Kernstück aus den Fragen, wie die<br />
Interviewpartnerinnen ihre Arbeit wahrnehmen, welche Auswirkungen die Arbeit<br />
auf sie als Person (sowohl beruflich als auch privat) hat und wie sie mit<br />
Belastungen umgehen, ohne dabei mit Fragen nach positiven oder negativen<br />
Aspekten eine Richtung vorzugeben. Nach dieser allgemeinen Fragestellung<br />
wurden die Interviewpartnerinnen gebeten, sich an die drei <strong>für</strong> sie schwierigsten<br />
und am meisten belastenden Fälle zu erinnern, deren Fallgeschichte grob zu<br />
umreißen und im Einzelnen zu erläutern, wie es ihnen bei der Behandlung erging<br />
und welche Quellen der Unterstützung sie bei besonderen Belastungssituationen<br />
herangezogen haben. Eine Interviewpartnerin hatte auf Anhieb vier Patientinnen<br />
vor Augen, aus der sie nicht drei auswählen wollte oder konnte, sodass hier von<br />
vier Fällen berichtet wurde. Daraus ergaben sich bei fünf Interviewpartnerinnen<br />
Berichte über 16 Patientinnen und deren Fallgeschichten, bzw.<br />
Behandlungsverläufe, sowie die jeweiligen Reaktionen der Therapeutinnen und<br />
Maßnahmen bzw. Ressourcen um mit Belastungssituationen umzugehen, die in<br />
7 Der Interview-Leitfaden ist einsehbar im Anhang A.<br />
53