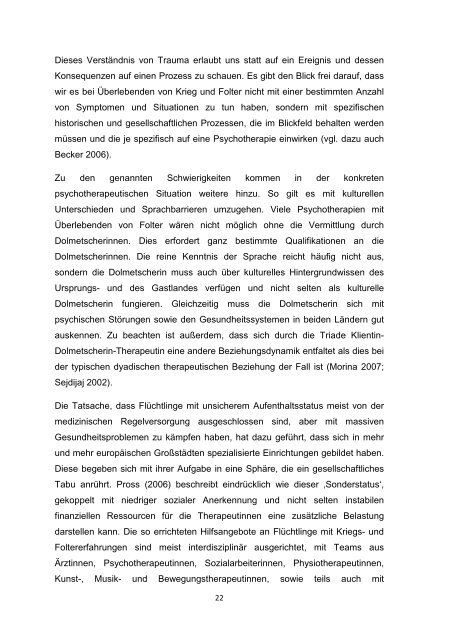Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dieses Verständnis von Trauma erlaubt uns statt auf ein Ereignis und dessen<br />
Konsequenzen auf einen Prozess zu schauen. Es gibt den Blick frei darauf, dass<br />
wir es bei Überlebenden von Krieg und Folter nicht mit einer bestimmten Anzahl<br />
von Symptomen und Situationen zu tun haben, sondern mit spezifischen<br />
historischen und gesellschaftlichen Prozessen, die im Blickfeld behalten werden<br />
müssen und die je spezifisch auf eine Psychotherapie einwirken (vgl. dazu auch<br />
Becker 2006).<br />
Zu den genannten Schwierigkeiten kommen in der konkreten<br />
psychotherapeutischen Situation weitere hinzu. So gilt es mit kulturellen<br />
Unterschieden und Sprachbarrieren umzugehen. Viele Psychotherapien mit<br />
Überlebenden von Folter wären nicht möglich ohne die Vermittlung durch<br />
Dolmetscherinnen. Dies erfordert ganz bestimmte Qualifikationen an die<br />
Dolmetscherinnen. Die reine Kenntnis der Sprache reicht häufig nicht aus,<br />
sondern die Dolmetscherin muss auch über kulturelles Hintergrundwissen des<br />
Ursprungs- und des Gastlandes verfügen und nicht selten als kulturelle<br />
Dolmetscherin fungieren. Gleichzeitig muss die Dolmetscherin sich mit<br />
psychischen Störungen sowie den Gesundheitssystemen in beiden Ländern gut<br />
auskennen. Zu beachten ist außerdem, dass sich durch die Triade Klientin-<br />
Dolmetscherin-Therapeutin eine andere Beziehungsdynamik entfaltet als dies bei<br />
der typischen dyadischen therapeutischen Beziehung der Fall ist (Morina 2007;<br />
Sejdijaj 2002).<br />
Die Tatsache, dass Flüchtlinge mit unsicherem Aufenthaltsstatus meist von der<br />
medizinischen Regelversorgung ausgeschlossen sind, aber mit massiven<br />
Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben, hat dazu geführt, dass sich in mehr<br />
und mehr europäischen Großstädten spezialisierte Einrichtungen gebildet haben.<br />
Diese begeben sich mit ihrer Aufgabe in eine Sphäre, die ein gesellschaftliches<br />
Tabu anrührt. Pross (2006) beschreibt eindrücklich wie dieser ‚Sonderstatus‘,<br />
gekoppelt mit niedriger sozialer Anerkennung und nicht selten instabilen<br />
finanziellen Ressourcen <strong>für</strong> die Therapeutinnen eine zusätzliche Belastung<br />
darstellen kann. Die so errichteten Hilfsangebote an Flüchtlinge mit Kriegs- und<br />
Foltererfahrungen sind meist interdisziplinär ausgerichtet, mit Teams aus<br />
Ärztinnen, Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiterinnen, Physiotherapeutinnen,<br />
Kunst-, Musik- und Bewegungstherapeutinnen, sowie teils auch mit<br />
22