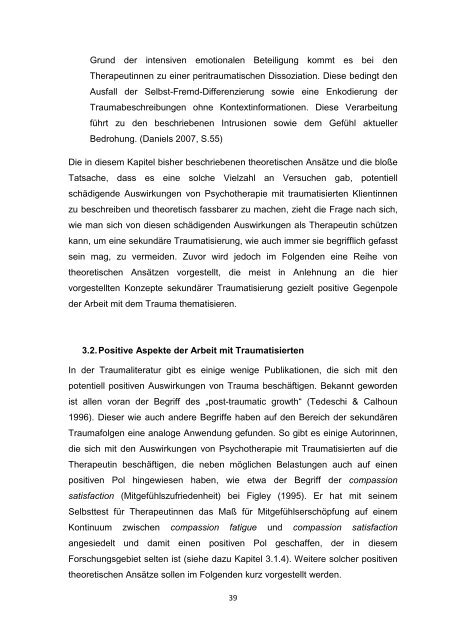Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Grund der intensiven emotionalen Beteiligung kommt es bei den<br />
Therapeutinnen zu einer peritraumatischen Dissoziation. Diese bedingt den<br />
Ausfall der Selbst-Fremd-Differenzierung sowie eine Enkodierung der<br />
Traumabeschreibungen ohne Kontextinformationen. Diese Verarbeitung<br />
führt zu den beschriebenen Intrusionen sowie dem Gefühl aktueller<br />
Bedrohung. (Daniels 2007, S.55)<br />
Die in diesem Kapitel bisher beschriebenen theoretischen Ansätze und die bloße<br />
Tatsache, dass es eine solche Vielzahl an Versuchen gab, potentiell<br />
schädigende Auswirkungen von Psychotherapie mit traumatisierten Klientinnen<br />
zu beschreiben und theoretisch fassbarer zu machen, zieht die Frage nach sich,<br />
wie man sich von diesen schädigenden Auswirkungen als Therapeutin schützen<br />
kann, um eine sekundäre <strong>Traumatisierung</strong>, wie auch immer sie begrifflich gefasst<br />
sein mag, zu vermeiden. Zuvor wird jedoch im Folgenden eine Reihe von<br />
theoretischen Ansätzen vorgestellt, die meist in Anlehnung an die hier<br />
vorgestellten Konzepte sekundärer <strong>Traumatisierung</strong> gezielt positive Gegenpole<br />
der Arbeit mit dem Trauma thematisieren.<br />
3.2. Positive Aspekte der Arbeit mit Traumatisierten<br />
In der Traumaliteratur gibt es einige wenige Publikationen, die sich mit den<br />
potentiell positiven Auswirkungen von Trauma beschäftigen. Bekannt geworden<br />
ist allen voran der Begriff des „post-traumatic growth“ (Tedeschi & Calhoun<br />
1996). Dieser wie auch andere Begriffe haben auf den Bereich der sekundären<br />
Traumafolgen eine analoge Anwendung gefunden. So gibt es einige Autorinnen,<br />
die sich mit den Auswirkungen von Psychotherapie mit Traumatisierten auf die<br />
Therapeutin beschäftigen, die neben möglichen Belastungen auch auf einen<br />
positiven Pol hingewiesen haben, wie etwa der Begriff der compassion<br />
satisfaction (Mitgefühlszufriedenheit) bei Figley (1995). Er hat mit seinem<br />
Selbsttest <strong>für</strong> Therapeutinnen das Maß <strong>für</strong> Mitgefühlserschöpfung auf einem<br />
Kontinuum zwischen compassion fatigue und compassion satisfaction<br />
angesiedelt und damit einen positiven Pol geschaffen, der in diesem<br />
Forschungsgebiet selten ist (siehe dazu Kapitel 3.1.4). Weitere solcher positiven<br />
theoretischen Ansätze sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.<br />
39