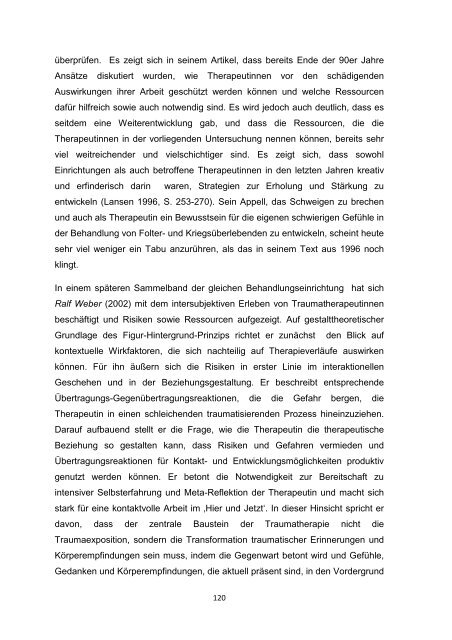Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
überprüfen. Es zeigt sich in seinem Artikel, dass bereits Ende der 90er Jahre<br />
Ansätze diskutiert wurden, wie Therapeutinnen vor den schädigenden<br />
Auswirkungen ihrer Arbeit geschützt werden können und welche Ressourcen<br />
da<strong>für</strong> hilfreich sowie auch notwendig sind. Es wird jedoch auch deutlich, dass es<br />
seitdem eine Weiterentwicklung gab, und dass die Ressourcen, die die<br />
Therapeutinnen in der vorliegenden Untersuchung nennen können, bereits sehr<br />
viel weitreichender und vielschichtiger sind. Es zeigt sich, dass sowohl<br />
Einrichtungen als auch betroffene Therapeutinnen in den letzten Jahren kreativ<br />
und erfinderisch darin waren, Strategien zur Erholung und Stärkung zu<br />
entwickeln (Lansen 1996, S. 253-270). Sein Appell, das Schweigen zu brechen<br />
und auch als Therapeutin ein Bewusstsein <strong>für</strong> die eigenen schwierigen Gefühle in<br />
der Behandlung von Folter- und Kriegsüberlebenden zu entwickeln, scheint heute<br />
sehr viel weniger ein Tabu anzurühren, als das in seinem Text aus 1996 noch<br />
klingt.<br />
In einem späteren Sammelband der gleichen Behandlungseinrichtung hat sich<br />
Ralf Weber (2002) mit dem intersubjektiven Erleben von Traumatherapeutinnen<br />
beschäftigt und Risiken sowie Ressourcen aufgezeigt. Auf gestalttheoretischer<br />
Grundlage des Figur-Hintergrund-Prinzips richtet er zunächst den Blick auf<br />
kontextuelle Wirkfaktoren, die sich nachteilig auf Therapieverläufe auswirken<br />
können. Für ihn äußern sich die Risiken in erster Linie im interaktionellen<br />
Geschehen und in der Beziehungsgestaltung. Er beschreibt entsprechende<br />
Übertragungs-Gegenübertragungsreaktionen, die die Gefahr bergen, die<br />
Therapeutin in einen schleichenden traumatisierenden Prozess hineinzuziehen.<br />
Darauf aufbauend stellt er die Frage, wie die Therapeutin die therapeutische<br />
Beziehung so gestalten kann, dass Risiken und Gefahren vermieden und<br />
Übertragungsreaktionen <strong>für</strong> Kontakt- und Entwicklungsmöglichkeiten produktiv<br />
genutzt werden können. Er betont die Notwendigkeit zur Bereitschaft zu<br />
intensiver Selbsterfahrung und Meta-Reflektion der Therapeutin und macht sich<br />
stark <strong>für</strong> eine kontaktvolle Arbeit im ‚Hier und Jetzt‘. In dieser Hinsicht spricht er<br />
davon, dass der zentrale Baustein der Traumatherapie nicht die<br />
Traumaexposition, sondern die Transformation traumatischer Erinnerungen und<br />
Körperempfindungen sein muss, indem die Gegenwart betont wird und Gefühle,<br />
Gedanken und Körperempfindungen, die aktuell präsent sind, in den Vordergrund<br />
120