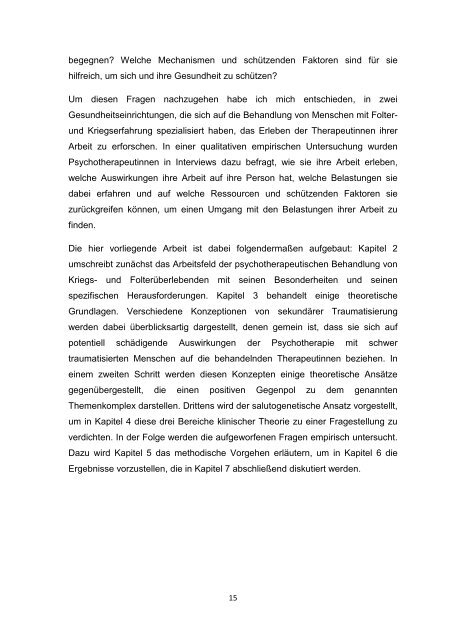Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
egegnen? Welche Mechanismen und schützenden <strong>Faktoren</strong> sind <strong>für</strong> sie<br />
hilfreich, um sich und ihre Gesundheit zu schützen?<br />
Um diesen Fragen nachzugehen habe ich mich entschieden, in zwei<br />
Gesundheitseinrichtungen, die sich auf die Behandlung von Menschen mit Folter-<br />
und Kriegserfahrung spezialisiert haben, das Erleben der Therapeutinnen ihrer<br />
Arbeit zu erforschen. In einer qualitativen empirischen Untersuchung wurden<br />
Psychotherapeutinnen in Interviews dazu befragt, wie sie ihre Arbeit erleben,<br />
welche Auswirkungen ihre Arbeit auf ihre Person hat, welche Belastungen sie<br />
dabei erfahren und auf welche Ressourcen und schützenden <strong>Faktoren</strong> sie<br />
zurückgreifen können, um einen Umgang mit den Belastungen ihrer Arbeit zu<br />
finden.<br />
Die hier vorliegende Arbeit ist dabei folgendermaßen aufgebaut: Kapitel 2<br />
umschreibt zunächst das Arbeitsfeld der psychotherapeutischen Behandlung von<br />
Kriegs- und Folterüberlebenden mit seinen Besonderheiten und seinen<br />
spezifischen Herausforderungen. Kapitel 3 behandelt einige theoretische<br />
Grundlagen. Verschiedene Konzeptionen von sekundärer <strong>Traumatisierung</strong><br />
werden dabei überblicksartig dargestellt, denen gemein ist, dass sie sich auf<br />
potentiell schädigende Auswirkungen der Psychotherapie mit schwer<br />
traumatisierten Menschen auf die behandelnden Therapeutinnen beziehen. In<br />
einem zweiten Schritt werden diesen Konzepten einige theoretische Ansätze<br />
<strong>gegen</strong>übergestellt, die einen positiven Gegenpol zu dem genannten<br />
Themenkomplex darstellen. Drittens wird der salutogenetische Ansatz vorgestellt,<br />
um in Kapitel 4 diese drei Bereiche klinischer Theorie zu einer Fragestellung zu<br />
verdichten. In der Folge werden die aufgeworfenen Fragen empirisch untersucht.<br />
Dazu wird Kapitel 5 das methodische Vorgehen erläutern, um in Kapitel 6 die<br />
Ergebnisse vorzustellen, die in Kapitel 7 abschließend diskutiert werden.<br />
15