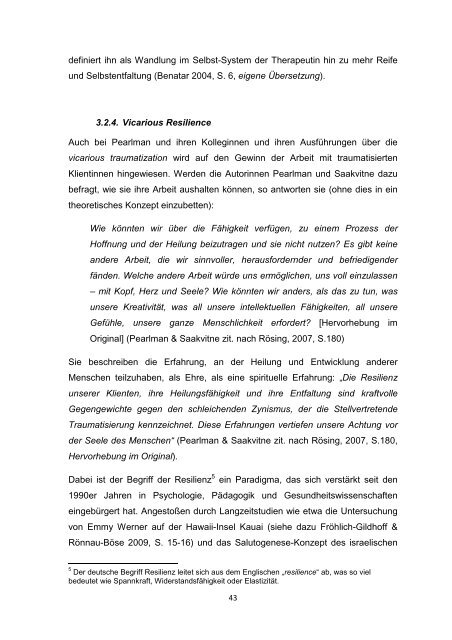Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Protektive Faktoren gegen Sekundäre Traumatisierung für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
definiert ihn als Wandlung im Selbst-System der Therapeutin hin zu mehr Reife<br />
und Selbstentfaltung (Benatar 2004, S. 6, eigene Übersetzung).<br />
3.2.4. Vicarious Resilience<br />
Auch bei Pearlman und ihren Kolleginnen und ihren Ausführungen über die<br />
vicarious traumatization wird auf den Gewinn der Arbeit mit traumatisierten<br />
Klientinnen hingewiesen. Werden die Autorinnen Pearlman und Saakvitne dazu<br />
befragt, wie sie ihre Arbeit aushalten können, so antworten sie (ohne dies in ein<br />
theoretisches Konzept einzubetten):<br />
Wie könnten wir über die Fähigkeit verfügen, zu einem Prozess der<br />
Hoffnung und der Heilung beizutragen und sie nicht nutzen? Es gibt keine<br />
andere Arbeit, die wir sinnvoller, herausfordernder und befriedigender<br />
fänden. Welche andere Arbeit würde uns ermöglichen, uns voll einzulassen<br />
– mit Kopf, Herz und Seele? Wie könnten wir anders, als das zu tun, was<br />
unsere Kreativität, was all unsere intellektuellen Fähigkeiten, all unsere<br />
Gefühle, unsere ganze Menschlichkeit erfordert? [Hervorhebung im<br />
Original] (Pearlman & Saakvitne zit. nach Rösing, 2007, S.180)<br />
Sie beschreiben die Erfahrung, an der Heilung und Entwicklung anderer<br />
Menschen teilzuhaben, als Ehre, als eine spirituelle Erfahrung: „Die Resilienz<br />
unserer Klienten, ihre Heilungsfähigkeit und ihre Entfaltung sind kraftvolle<br />
Gegengewichte <strong>gegen</strong> den schleichenden Zynismus, der die Stellvertretende<br />
<strong>Traumatisierung</strong> kennzeichnet. Diese Erfahrungen vertiefen unsere Achtung vor<br />
der Seele des Menschen“ (Pearlman & Saakvitne zit. nach Rösing, 2007, S.180,<br />
Hervorhebung im Original).<br />
Dabei ist der Begriff der Resilienz 5 ein Paradigma, das sich verstärkt seit den<br />
1990er Jahren in Psychologie, Pädagogik und Gesundheitswissenschaften<br />
eingebürgert hat. Angestoßen durch Langzeitstudien wie etwa die Untersuchung<br />
von Emmy Werner auf der Hawaii-Insel Kauai (siehe dazu Fröhlich-Gildhoff &<br />
Rönnau-Böse 2009, S. 15-16) und das Salutogenese-Konzept des israelischen<br />
5 Der deutsche Begriff Resilienz leitet sich aus dem Englischen „resilience“ ab, was so viel<br />
bedeutet wie Spannkraft, Widerstandsfähigkeit oder Elastizität.<br />
43