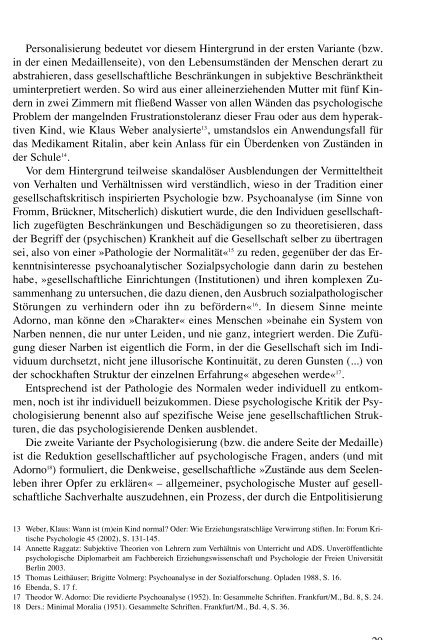Schöne neue Demokratie - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Schöne neue Demokratie - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Schöne neue Demokratie - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Personalisierung bedeutet vor diesem Hintergrund in der ersten Variante (bzw.<br />
in der einen Medaillenseite), von den Lebensumständen der Menschen derart zu<br />
abstrahieren, dass gesellschaftliche Beschränkungen in subjektive Beschränktheit<br />
uminterpretiert werden. So wird aus einer alleinerziehenden Mutter mit fünf Kindern<br />
in zwei Zimmern mit fließend Wasser von allen Wänden das psychologische<br />
Problem der mangelnden Frustrationstoleranz dieser Frau oder aus dem hyperaktiven<br />
Kind, wie Klaus Weber analysierte 13 , umstandslos ein Anwendungsfall für<br />
das Medikament Ritalin, aber kein Anlass für ein Überdenken von Zuständen in<br />
der Schule 14 .<br />
Vor dem Hintergrund teilweise skandalöser Ausblendungen der Vermitteltheit<br />
von Verhalten und Verhältnissen wird verständlich, wieso in der Tradition einer<br />
gesellschaftskritisch inspirierten Psychologie bzw. Psychoanalyse (im Sinne von<br />
Fromm, Brückner, Mitscherlich) diskutiert wurde, die den Individuen gesellschaftlich<br />
zugefügten Beschränkungen und Beschädigungen so zu theoretisieren, dass<br />
der Begriff der (psychischen) Krankheit auf die Gesellschaft selber zu übertragen<br />
sei, also von einer »Pathologie der Normalität« 15 zu reden, gegenüber der das Erkenntnisinteresse<br />
psychoanalytischer Sozialpsychologie dann darin zu bestehen<br />
habe, »gesellschaftliche Einrichtungen (Institutionen) und ihren komplexen Zusammenhang<br />
zu untersuchen, die dazu dienen, den Ausbruch sozialpathologischer<br />
Störungen zu verhindern oder ihn zu befördern« 16 . In diesem Sinne meinte<br />
Adorno, man könne den »Charakter« eines Menschen »beinahe ein System von<br />
Narben nennen, die nur unter Leiden, und nie ganz, integriert werden. Die Zufügung<br />
dieser Narben ist eigentlich die Form, in der die Gesellschaft sich im Individuum<br />
durchsetzt, nicht jene illusorische Kontinuität, zu deren Gunsten (...) von<br />
der schockhaften Struktur der einzelnen Erfahrung« abgesehen werde« 17 .<br />
Entsprechend ist der Pathologie des Normalen weder individuell zu entkommen,<br />
noch ist ihr individuell beizukommen. Diese psychologische Kritik der Psychologisierung<br />
benennt also auf spezifische Weise jene gesellschaftlichen Strukturen,<br />
die das psychologisierende Denken ausblendet.<br />
Die zweite Variante der Psychologisierung (bzw. die andere Seite der Medaille)<br />
ist die Reduktion gesellschaftlicher auf psychologische Fragen, anders (und mit<br />
Adorno 18 ) formuliert, die Denkweise, gesellschaftliche »Zustände aus dem Seelenleben<br />
ihrer Opfer zu erklären« – allgemeiner, psychologische Muster auf gesellschaftliche<br />
Sachverhalte auszudehnen, ein Prozess, der durch die Entpolitisierung<br />
13 Weber, Klaus: Wann ist (m)ein Kind normal? Oder: Wie Erziehungsratschläge Verwirrung stiften. In: Forum Kritische<br />
Psychologie 45 (2002), S. 131-145.<br />
14 Annette Raggatz: Subjektive Theorien von Lehrern zum Verhältnis von Unterricht und ADS. Unveröffentlichte<br />
psychologische Diplomarbeit am Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität<br />
Berlin 2003.<br />
15 Thomas Leithäuser; Brigitte Volmerg: Psychoanalyse in der Sozialforschung. Opladen 1988, S. 16.<br />
16 Ebenda, S. 17 f.<br />
17 Theodor W. Adorno: Die revidierte Psychoanalyse (1952). In: Gesammelte Schriften. Frankfurt/M., Bd. 8, S. 24.<br />
18 Ders.: Minimal Moralia (1951). Gesammelte Schriften. Frankfurt/M., Bd. 4, S. 36.<br />
29