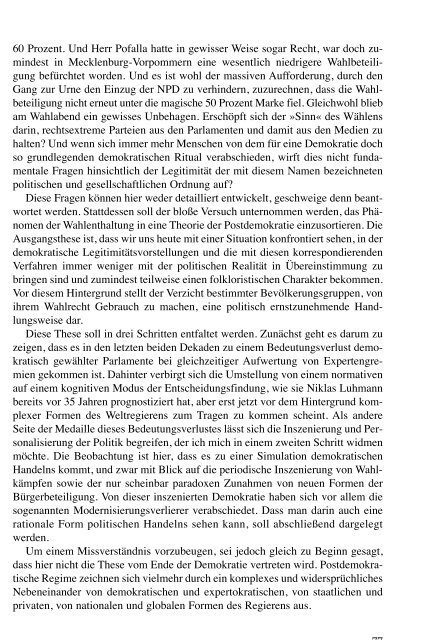Schöne neue Demokratie - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Schöne neue Demokratie - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Schöne neue Demokratie - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
60 Prozent. Und Herr Pofalla hatte in gewisser Weise sogar Recht, war doch zumindest<br />
in Mecklenburg-Vorpommern eine wesentlich niedrigere Wahlbeteiligung<br />
befürchtet worden. Und es ist wohl der massiven Aufforderung, durch den<br />
Gang zur Urne den Einzug der NPD zu verhindern, zuzurechnen, dass die Wahlbeteiligung<br />
nicht erneut unter die magische 50 Prozent Marke fiel. Gleichwohl blieb<br />
am Wahlabend ein gewisses Unbehagen. Erschöpft sich der »Sinn« des Wählens<br />
darin, rechtsextreme Parteien aus den Parlamenten und damit aus den Medien zu<br />
halten? Und wenn sich immer mehr Menschen von dem für eine <strong>Demokratie</strong> doch<br />
so grundlegenden demokratischen Ritual verabschieden, wirft dies nicht fundamentale<br />
Fragen hinsichtlich der Legitimität der mit diesem Namen bezeichneten<br />
politischen und gesellschaftlichen Ordnung auf?<br />
Diese Fragen können hier weder detailliert entwickelt, geschweige denn beantwortet<br />
werden. Stattdessen soll der bloße Versuch unternommen werden, das Phänomen<br />
der Wahlenthaltung in eine Theorie der Postdemokratie einzusortieren. Die<br />
Ausgangsthese ist, dass wir uns heute mit einer Situation konfrontiert sehen, in der<br />
demokratische Legitimitätsvorstellungen und die mit diesen korrespondierenden<br />
Verfahren immer weniger mit der politischen Realität in Übereinstimmung zu<br />
bringen sind und zumindest teilweise einen folkloristischen Charakter bekommen.<br />
Vor diesem Hintergrund stellt der Verzicht bestimmter Bevölkerungsgruppen, von<br />
ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, eine politisch ernstzunehmende Handlungsweise<br />
dar.<br />
Diese These soll in drei Schritten entfaltet werden. Zunächst geht es darum zu<br />
zeigen, dass es in den letzten beiden Dekaden zu einem Bedeutungsverlust demokratisch<br />
gewählter Parlamente bei gleichzeitiger Aufwertung von Expertengremien<br />
gekommen ist. Dahinter verbirgt sich die Umstellung von einem normativen<br />
auf einem kognitiven Modus der Entscheidungsfindung, wie sie Niklas Luhmann<br />
bereits vor 35 Jahren prognostiziert hat, aber erst jetzt vor dem Hintergrund komplexer<br />
Formen des Weltregierens zum Tragen zu kommen scheint. Als andere<br />
Seite der Medaille dieses Bedeutungsverlustes lässt sich die Inszenierung und Personalisierung<br />
der Politik begreifen, der ich mich in einem zweiten Schritt widmen<br />
möchte. Die Beobachtung ist hier, dass es zu einer Simulation demokratischen<br />
Handelns kommt, und zwar mit Blick auf die periodische Inszenierung von Wahlkämpfen<br />
sowie der nur scheinbar paradoxen Zunahmen von <strong>neue</strong>n Formen der<br />
Bürgerbeteiligung. Von dieser inszenierten <strong>Demokratie</strong> haben sich vor allem die<br />
sogenannten Modernisierungsverlierer verabschiedet. Dass man darin auch eine<br />
rationale Form politischen Handelns sehen kann, soll abschließend dargelegt<br />
werden.<br />
Um einem Missverständnis vorzubeugen, sei jedoch gleich zu Beginn gesagt,<br />
dass hier nicht die These vom Ende der <strong>Demokratie</strong> vertreten wird. Postdemokratische<br />
Regime zeichnen sich vielmehr durch ein komplexes und widersprüchliches<br />
Nebeneinander von demokratischen und expertokratischen, von staatlichen und<br />
privaten, von nationalen und globalen Formen des Regierens aus.<br />
77