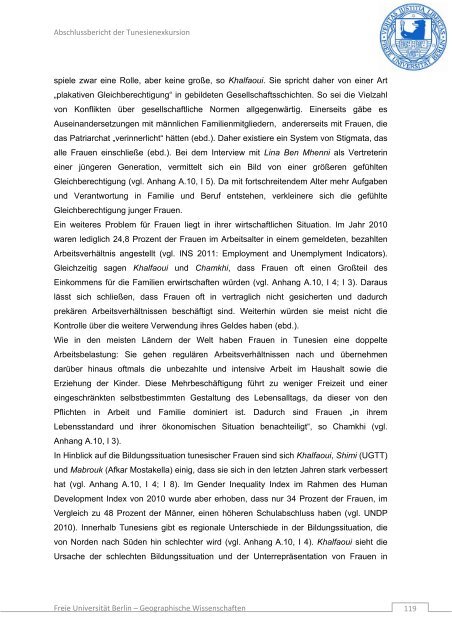Vollständiger Abschlussbericht als pdf-Download - Veränderungen ...
Vollständiger Abschlussbericht als pdf-Download - Veränderungen ...
Vollständiger Abschlussbericht als pdf-Download - Veränderungen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Abschlussbericht</strong> der Tunesienexkursion<br />
spiele zwar eine Rolle, aber keine große, so Khalfaoui. Sie spricht daher von einer Art<br />
„plakativen Gleichberechtigung“ in gebildeten Gesellschaftsschichten. So sei die Vielzahl<br />
von Konflikten über gesellschaftliche Normen allgegenwärtig. Einerseits gäbe es<br />
Auseinandersetzungen mit männlichen Familienmitgliedern, andererseits mit Frauen, die<br />
das Patriarchat „verinnerlicht“ hätten (ebd.). Daher existiere ein System von Stigmata, das<br />
alle Frauen einschließe (ebd.). Bei dem Interview mit Lina Ben Mhenni <strong>als</strong> Vertreterin<br />
einer jüngeren Generation, vermittelt sich ein Bild von einer größeren gefühlten<br />
Gleichberechtigung (vgl. Anhang A.10, I 5). Da mit fortschreitendem Alter mehr Aufgaben<br />
und Verantwortung in Familie und Beruf entstehen, verkleinere sich die gefühlte<br />
Gleichberechtigung junger Frauen.<br />
Ein weiteres Problem für Frauen liegt in ihrer wirtschaftlichen Situation. Im Jahr 2010<br />
waren lediglich 24,8 Prozent der Frauen im Arbeitsalter in einem gemeldeten, bezahlten<br />
Arbeitsverhältnis angestellt (vgl. INS 2011: Employment and Unemplyment Indicators).<br />
Gleichzeitig sagen Khalfaoui und Chamkhi, dass Frauen oft einen Großteil des<br />
Einkommens für die Familien erwirtschaften würden (vgl. Anhang A.10, I 4; I 3). Daraus<br />
lässt sich schließen, dass Frauen oft in vertraglich nicht gesicherten und dadurch<br />
prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind. Weiterhin würden sie meist nicht die<br />
Kontrolle über die weitere Verwendung ihres Geldes haben (ebd.).<br />
Wie in den meisten Ländern der Welt haben Frauen in Tunesien eine doppelte<br />
Arbeitsbelastung: Sie gehen regulären Arbeitsverhältnissen nach und übernehmen<br />
darüber hinaus oftm<strong>als</strong> die unbezahlte und intensive Arbeit im Haushalt sowie die<br />
Erziehung der Kinder. Diese Mehrbeschäftigung führt zu weniger Freizeit und einer<br />
eingeschränkten selbstbestimmten Gestaltung des Lebensalltags, da dieser von den<br />
Pflichten in Arbeit und Familie dominiert ist. Dadurch sind Frauen „in ihrem<br />
Lebensstandard und ihrer ökonomischen Situation benachteiligt“, so Chamkhi (vgl.<br />
Anhang A.10, I 3).<br />
In Hinblick auf die Bildungssituation tunesischer Frauen sind sich Khalfaoui, Shimi (UGTT)<br />
und Mabrouk (Afkar Mostakella) einig, dass sie sich in den letzten Jahren stark verbessert<br />
hat (vgl. Anhang A.10, I 4; I 8). Im Gender Inequality Index im Rahmen des Human<br />
Development Index von 2010 wurde aber erhoben, dass nur 34 Prozent der Frauen, im<br />
Vergleich zu 48 Prozent der Männer, einen höheren Schulabschluss haben (vgl. UNDP<br />
2010). Innerhalb Tunesiens gibt es regionale Unterschiede in der Bildungssituation, die<br />
von Norden nach Süden hin schlechter wird (vgl. Anhang A.10, I 4). Khalfaoui sieht die<br />
Ursache der schlechten Bildungssituation und der Unterrepräsentation von Frauen in<br />
Freie Universität Berlin – Geographische Wissenschaften 119