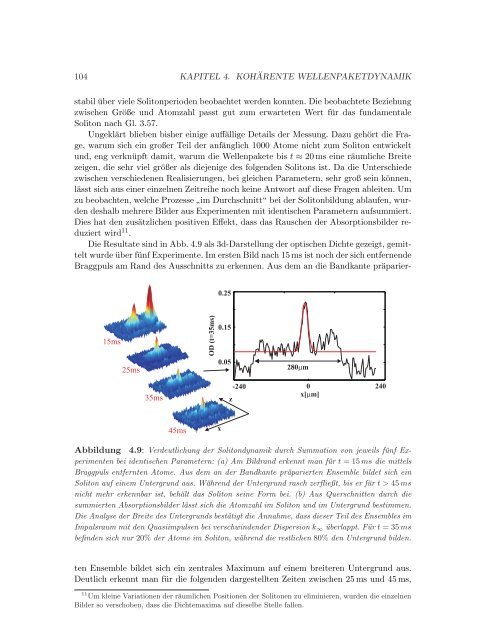Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
104 KAPITEL 4. KOHÄRENTE WELLENPAKETDYNAMIK<br />
stabil über viele Solitonperioden beobachtet werden konnten. Die beobachtete Beziehung<br />
zwischen Größe und Atomzahl passt gut zum erwarteten Wert für das fundamentale<br />
Soliton nach Gl. 3.57.<br />
Ungeklärt blieben bisher einige auffällige Details der Messung. Dazu gehört die Frage,<br />
warum sich ein großer Teil der anfänglich 1000 Atome nicht zum Soliton entwickelt<br />
und, eng verknüpft damit, warum die Wellenpakete bis t ≈ 20 ms eine räumliche Breite<br />
zeigen, die sehr viel größer als diejenige des folgenden Solitons ist. Da die Unterschiede<br />
zwischen verschiedenen Realisierungen, bei gleichen Parametern, sehr groß sein können,<br />
lässt sich aus einer einzelnen Zeitreihe noch keine Antwort auf diese Fragen ableiten. Um<br />
zu beobachten, welche Prozesse ”<br />
im Durchschnitt“ bei der Solitonbildung ablaufen, wurden<br />
deshalb mehrere Bilder aus Experimenten mit identischen Parametern aufsummiert.<br />
Dies hat den zusätzlichen positiven Effekt, dass das Rauschen der Absorptionsbilder reduziert<br />
wird 11 .<br />
Die Resultate sind in Abb. 4.9 als 3d-Darstellung der optischen Dichte gezeigt, gemittelt<br />
wurde über fünf Experimente. Im ersten Bild nach 15 ms ist noch der sich entfernende<br />
Braggpuls am Rand des Ausschnitts zu erkennen. Aus dem an die Bandkante präparier-<br />
0.25<br />
15ms<br />
25ms<br />
OD (t=35ms)<br />
0.15<br />
0.05<br />
280m<br />
35ms<br />
z<br />
-240<br />
0<br />
x[ m]<br />
240<br />
45ms<br />
x<br />
Abbildung 4.9: Verdeutlichung der Solitondynamik durch Summation von jeweils fünf Experimenten<br />
bei identischen Parametern: (a) Am Bildrand erkennt man für t = 15 ms die mittels<br />
Braggpuls entfernten Atome. Aus dem an der Bandkante präparierten Ensemble bildet sich ein<br />
Soliton auf einem Untergrund aus. Während der Untergrund rasch zerfließt, bis er für t > 45 ms<br />
nicht mehr erkennbar ist, behält das Soliton seine Form bei. (b) Aus Querschnitten durch die<br />
summierten Absorptionsbilder lässt sich die Atomzahl im Soliton und im Untergrund bestimmen.<br />
Die Analyse der Breite des Untergrunds bestätigt die Annahme, dass dieser Teil des Ensembles im<br />
Impulsraum mit den Quasiimpulsen bei verschwindender Dispersion k ∞ überlappt. Für t = 35 ms<br />
befinden sich nur 20% der Atome im Soliton, während die restlichen 80% den Untergrund bilden.<br />
ten Ensemble bildet sich ein zentrales Maximum auf einem breiteren Untergrund aus.<br />
Deutlich erkennt man für die folgenden dargestellten Zeiten zwischen 25 ms und 45 ms,<br />
11 Um kleine Variationen der räumlichen Positionen der <strong>Solitonen</strong> zu eliminieren, wurden die einzelnen<br />
Bilder so verschoben, dass die Dichtemaxima auf dieselbe Stelle fallen.