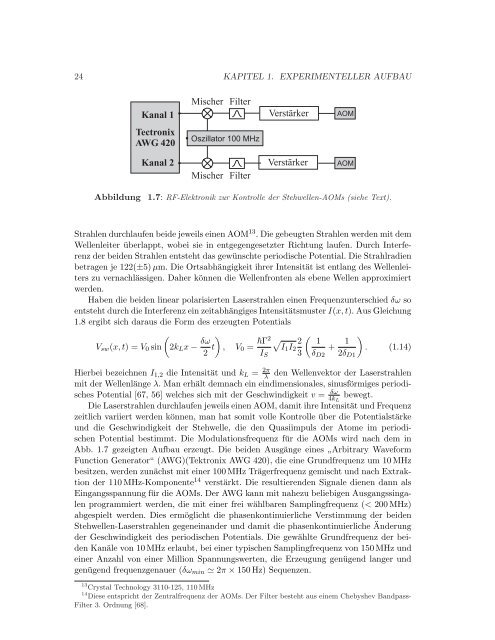Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
24 KAPITEL 1. EXPERIMENTELLER AUFBAU<br />
Kanal 1<br />
Mischer<br />
Filter<br />
Verstärker<br />
AOM<br />
Tectronix<br />
AWG 420<br />
Oszillator 100 MHz<br />
Kanal 2<br />
Mischer<br />
Filter<br />
Verstärker<br />
AOM<br />
Abbildung<br />
1.7: RF-Elektronik zur Kontrolle der Stehwellen-AOMs (siehe Text).<br />
Strahlen durchlaufen beide jeweils einen AOM 13 . Die gebeugten Strahlen werden mit dem<br />
Wellenleiter überlappt, wobei sie in entgegengesetzter Richtung laufen. Durch Interferenz<br />
der beiden Strahlen entsteht das gewünschte periodische Potential. Die Strahlradien<br />
betragen je 122(±5) µm. Die Ortsabhängigkeit ihrer Intensität ist entlang des Wellenleiters<br />
zu vernachlässigen. Daher können die Wellenfronten als ebene Wellen approximiert<br />
werden.<br />
Haben die beiden linear polarisierten Laserstrahlen einen Frequenzunterschied δω so<br />
entsteht durch die Interferenz ein zeitabhängiges Intensitätsmuster I(x, t). Aus Gleichung<br />
1.8 ergibt sich daraus die Form des erzeugten Potentials<br />
V sw (x, t) = V 0 sin<br />
(2k L x − δω )<br />
2 t , V 0 = Γ2 √<br />
(<br />
2 1<br />
I1 I 2 + 1 )<br />
. (1.14)<br />
I S 3 δ D2 2δ D1<br />
Hierbei bezeichnen I 1,2 die Intensität und k L = 2π λ<br />
den Wellenvektor der Laserstrahlen<br />
mit der Wellenlänge λ. Man erhält demnach ein eindimensionales, sinusförmiges periodisches<br />
Potential [67, 56] welches sich mit der Geschwindigkeit v = δω<br />
4k L<br />
bewegt.<br />
Die Laserstrahlen durchlaufen jeweils einen AOM, damit ihre Intensität und Frequenz<br />
zeitlich variiert werden können, man hat somit volle Kontrolle über die Potentialstärke<br />
und die Geschwindigkeit der Stehwelle, die den Quasiimpuls der Atome im periodischen<br />
Potential bestimmt. Die Modulationsfrequenz für die AOMs wird nach dem in<br />
Abb. 1.7 gezeigten Aufbau erzeugt. Die beiden Ausgänge eines Arbitrary Waveform<br />
”<br />
Function Generator“ (AWG)(Tektronix AWG 420), die eine Grundfrequenz um 10 MHz<br />
besitzen, werden zunächst mit einer 100 MHz Trägerfrequenz gemischt und nach Extraktion<br />
der 110 MHz-Komponente 14 verstärkt. Die resultierenden Signale dienen dann als<br />
Eingangsspannung für die AOMs. Der AWG kann mit nahezu beliebigen Ausgangssingalen<br />
programmiert werden, die mit einer frei wählbaren Samplingfrequenz (< 200 MHz)<br />
abgespielt werden. Dies ermöglicht die phasenkontinuierliche Verstimmung der beiden<br />
Stehwellen-Laserstrahlen gegeneinander und damit die phasenkontinuierliche Änderung<br />
der Geschwindigkeit des periodischen Potentials. Die gewählte Grundfrequenz der beiden<br />
Kanäle von 10 MHz erlaubt, bei einer typischen Samplingfrequenz von 150 MHz und<br />
einer Anzahl von einer Million Spannungswerten, die Erzeugung genügend langer und<br />
genügend frequenzgenauer (δω min ≃ 2π × 150 Hz) Sequenzen.<br />
13 Crystal Technology 3110-125, 110 MHz<br />
14 Diese entspricht der Zentralfrequenz der AOMs. Der Filter besteht aus einem Chebyshev Bandpass-<br />
Filter 3. Ordnung [68].