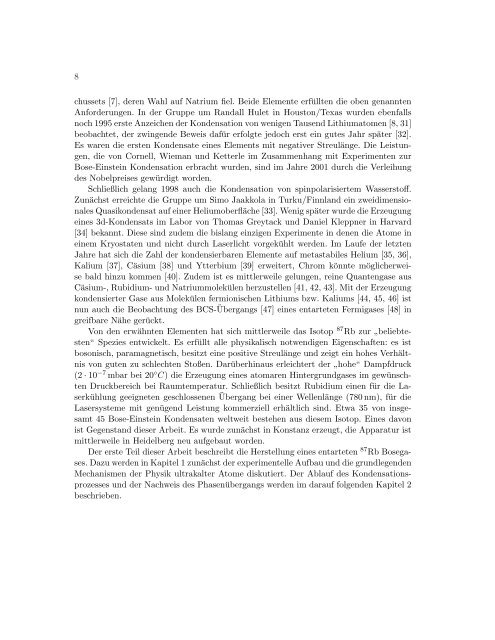Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
8<br />
chussets [7], deren Wahl auf Natrium fiel. Beide Elemente erfüllten die oben genannten<br />
Anforderungen. In der Gruppe um Randall Hulet in Houston/Texas wurden ebenfalls<br />
noch 1995 erste Anzeichen der Kondensation von wenigen Tausend Lithiumatomen [8, 31]<br />
beobachtet, der zwingende Beweis dafür erfolgte jedoch erst ein gutes Jahr später [32].<br />
Es waren die ersten Kondensate eines Elements mit negativer Streulänge. Die Leistungen,<br />
die von Cornell, Wieman und Ketterle im Zusammenhang mit Experimenten zur<br />
Bose-Einstein Kondensation erbracht wurden, sind im Jahre 2001 durch die Verleihung<br />
des Nobelpreises gewürdigt worden.<br />
Schließlich gelang 1998 auch die Kondensation von spinpolarisiertem Wasserstoff.<br />
Zunächst erreichte die Gruppe um Simo Jaakkola in Turku/Finnland ein zweidimensionales<br />
Quasikondensat auf einer Heliumoberfläche [33]. Wenig später wurde die Erzeugung<br />
eines 3d-Kondensats im Labor von Thomas Greytack und Daniel Kleppner in Harvard<br />
[34] bekannt. Diese sind zudem die bislang einzigen Experimente in denen die Atome in<br />
einem Kryostaten und nicht durch Laserlicht vorgekühlt werden. Im Laufe der letzten<br />
Jahre hat sich die Zahl der kondensierbaren Elemente auf metastabiles Helium [35, 36],<br />
Kalium [37], Cäsium [38] und Ytterbium [39] erweitert, Chrom könnte möglicherweise<br />
bald hinzu kommen [40]. Zudem ist es mittlerweile gelungen, reine Quantengase aus<br />
Cäsium-, Rubidium- und Natriummolekülen herzustellen [41, 42, 43]. Mit der Erzeugung<br />
kondensierter Gase aus Molekülen fermionischen Lithiums bzw. Kaliums [44, 45, 46] ist<br />
nun auch die Beobachtung des BCS-Übergangs [47] eines entarteten Fermigases [48] in<br />
greifbare Nähe gerückt.<br />
Von den erwähnten Elementen hat sich mittlerweile das Isotop 87 Rb zur ”<br />
beliebtesten“<br />
Spezies entwickelt. Es erfüllt alle physikalisch notwendigen Eigenschaften: es ist<br />
bosonisch, paramagnetisch, besitzt eine positive Streulänge und zeigt ein hohes Verhältnis<br />
von guten zu schlechten Stoßen. Darüberhinaus erleichtert der ”<br />
hohe“ Dampfdruck<br />
(2 · 10 −7 mbar bei 20 ◦ C) die Erzeugung eines <strong>atomare</strong>n Hintergrundgases im gewünschten<br />
Druckbereich bei Raumtemperatur. Schließlich besitzt Rubidium einen für die Laserkühlung<br />
geeigneten geschlossenen Übergang bei einer Wellenlänge (780 nm), für die<br />
Lasersysteme mit genügend Leistung kommerziell erhältlich sind. Etwa 35 von insgesamt<br />
45 Bose-Einstein Kondensaten weltweit bestehen aus diesem Isotop. Eines davon<br />
ist Gegenstand dieser Arbeit. Es wurde zunächst in <strong>Konstanz</strong> erzeugt, die Apparatur ist<br />
mittlerweile in Heidelberg neu aufgebaut worden.<br />
Der erste Teil dieser Arbeit beschreibt die Herstellung eines entarteten 87 Rb Bosegases.<br />
Dazu werden in Kapitel 1 zunächst der experimentelle Aufbau und die grundlegenden<br />
Mechanismen der Physik ultrakalter Atome diskutiert. Der Ablauf des Kondensationsprozesses<br />
und der Nachweis des Phasenübergangs werden im darauf folgenden Kapitel 2<br />
beschrieben.