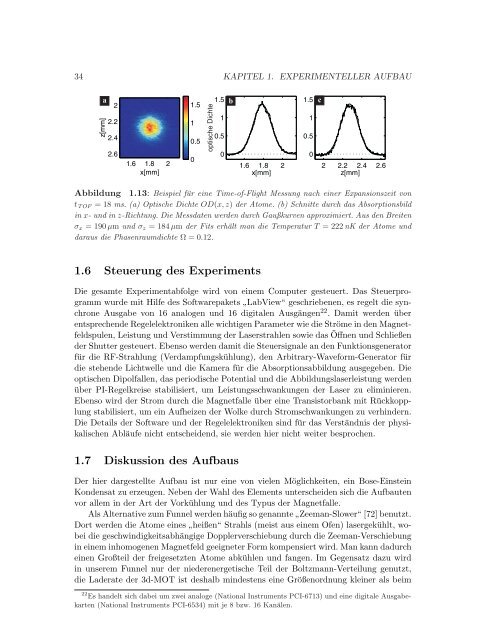Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
34 KAPITEL 1. EXPERIMENTELLER AUFBAU<br />
a<br />
b<br />
c<br />
Abbildung 1.13: Beispiel für eine Time-of-Flight Messung nach einer Expansionszeit von<br />
t TOF = 18 ms. (a) Optische Dichte OD(x, z) der Atome. (b) Schnitte durch das Absorptionsbild<br />
in x- und in z-Richtung. Die Messdaten werden durch Gaußkurven approximiert. Aus den Breiten<br />
σ x = 190 µm und σ z = 184 µm der Fits erhält man die Temperatur T = 222 nK der Atome und<br />
daraus die Phasenraumdichte Ω = 0.12.<br />
1.6 Steuerung des Experiments<br />
Die gesamte Experimentabfolge wird von einem Computer gesteuert. Das Steuerprogramm<br />
wurde mit Hilfe des Softwarepakets ”<br />
LabView“ geschriebenen, es regelt die synchrone<br />
Ausgabe von 16 analogen und 16 digitalen Ausgängen 22 . Damit werden über<br />
entsprechende Regelelektroniken alle wichtigen Parameter wie die Ströme in den Magnetfeldspulen,<br />
Leistung und Verstimmung der Laserstrahlen sowie das Öffnen und Schließen<br />
der Shutter gesteuert. Ebenso werden damit die Steuersignale an den Funktionsgenerator<br />
für die RF-Strahlung (Verdampfungskühlung), den Arbitrary-Waveform-Generator für<br />
die stehende Lichtwelle und die Kamera für die Absorptionsabbildung ausgegeben. Die<br />
optischen Dipolfallen, das periodische Potential und die Abbildungslaserleistung werden<br />
über PI-Regelkreise stabilisiert, um Leistungsschwankungen der Laser zu eliminieren.<br />
Ebenso wird der Strom durch die Magnetfalle über eine Transistorbank mit Rückkopplung<br />
stabilisiert, um ein Aufheizen der Wolke durch Stromschwankungen zu verhindern.<br />
Die Details der Software und der Regelelektroniken sind für das Verständnis der physikalischen<br />
Abläufe nicht entscheidend, sie werden hier nicht weiter besprochen.<br />
1.7 Diskussion des Aufbaus<br />
Der hier dargestellte Aufbau ist nur eine von vielen Möglichkeiten, ein Bose-Einstein<br />
Kondensat zu erzeugen. Neben der Wahl des Elements unterscheiden sich die Aufbauten<br />
vor allem in der Art der Vorkühlung und des Typus der Magnetfalle.<br />
Als Alternative zum Funnel werden häufig so genannte ”<br />
Zeeman-Slower“ [72] benutzt.<br />
Dort werden die Atome eines ”<br />
heißen“ Strahls (meist aus einem Ofen) lasergekühlt, wobei<br />
die geschwindigkeitsabhängige Dopplerverschiebung durch die Zeeman-Verschiebung<br />
in einem inhomogenen Magnetfeld geeigneter Form kompensiert wird. Man kann dadurch<br />
einen Großteil der freigesetzten Atome abkühlen und fangen. Im Gegensatz dazu wird<br />
in unserem Funnel nur der niederenergetische Teil der Boltzmann-Verteilung genutzt,<br />
die Laderate der 3d-MOT ist deshalb mindestens eine Größenordnung kleiner als beim<br />
22 Es handelt sich dabei um zwei analoge (National Instruments PCI-6713) und eine digitale Ausgabekarten<br />
(National Instruments PCI-6534) mit je 8 bzw. 16 Kanälen.