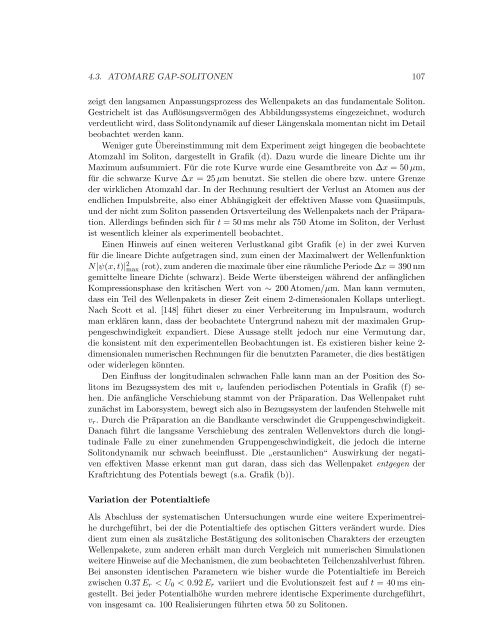Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Helle atomare Solitonen - KOPS - Universität Konstanz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.3. ATOMARE GAP-SOLITONEN 107<br />
zeigt den langsamen Anpassungsprozess des Wellenpakets an das fundamentale Soliton.<br />
Gestrichelt ist das Auflösungsvermögen des Abbildungssystems eingezeichnet, wodurch<br />
verdeutlicht wird, dass Solitondynamik auf dieser Längenskala momentan nicht im Detail<br />
beobachtet werden kann.<br />
Weniger gute Übereinstimmung mit dem Experiment zeigt hingegen die beobachtete<br />
Atomzahl im Soliton, dargestellt in Grafik (d). Dazu wurde die lineare Dichte um ihr<br />
Maximum aufsummiert. Für die rote Kurve wurde eine Gesamtbreite von ∆x = 50 µm,<br />
für die schwarze Kurve ∆x = 25 µm benutzt. Sie stellen die obere bzw. untere Grenze<br />
der wirklichen Atomzahl dar. In der Rechnung resultiert der Verlust an Atomen aus der<br />
endlichen Impulsbreite, also einer Abhängigkeit der effektiven Masse vom Quasiimpuls,<br />
und der nicht zum Soliton passenden Ortsverteilung des Wellenpakets nach der Präparation.<br />
Allerdings befinden sich für t = 50 ms mehr als 750 Atome im Soliton, der Verlust<br />
ist wesentlich kleiner als experimentell beobachtet.<br />
Einen Hinweis auf einen weiteren Verlustkanal gibt Grafik (e) in der zwei Kurven<br />
für die lineare Dichte aufgetragen sind, zum einen der Maximalwert der Wellenfunktion<br />
N|ψ(x, t)| 2 max (rot), zum anderen die maximale über eine räumliche Periode ∆x = 390 nm<br />
gemittelte lineare Dichte (schwarz). Beide Werte übersteigen während der anfänglichen<br />
Kompressionsphase den kritischen Wert von ∼ 200 Atomen/µm. Man kann vermuten,<br />
dass ein Teil des Wellenpakets in dieser Zeit einem 2-dimensionalen Kollaps unterliegt.<br />
Nach Scott et al. [148] führt dieser zu einer Verbreiterung im Impulsraum, wodurch<br />
man erklären kann, dass der beobachtete Untergrund nahezu mit der maximalen Gruppengeschwindigkeit<br />
expandiert. Diese Aussage stellt jedoch nur eine Vermutung dar,<br />
die konsistent mit den experimentellen Beobachtungen ist. Es existieren bisher keine 2-<br />
dimensionalen numerischen Rechnungen für die benutzten Parameter, die dies bestätigen<br />
oder widerlegen könnten.<br />
Den Einfluss der longitudinalen schwachen Falle kann man an der Position des Solitons<br />
im Bezugssystem des mit v r laufenden periodischen Potentials in Grafik (f) sehen.<br />
Die anfängliche Verschiebung stammt von der Präparation. Das Wellenpaket ruht<br />
zunächst im Laborsystem, bewegt sich also in Bezugssystem der laufenden Stehwelle mit<br />
v r . Durch die Präparation an die Bandkante verschwindet die Gruppengeschwindigkeit.<br />
Danach führt die langsame Verschiebung des zentralen Wellenvektors durch die longitudinale<br />
Falle zu einer zunehmenden Gruppengeschwindigkeit, die jedoch die interne<br />
Solitondynamik nur schwach beeinflusst. Die ”<br />
erstaunlichen“ Auswirkung der negativen<br />
effektiven Masse erkennt man gut daran, dass sich das Wellenpaket entgegen der<br />
Kraftrichtung des Potentials bewegt (s.a. Grafik (b)).<br />
Variation der Potentialtiefe<br />
Als Abschluss der systematischen Untersuchungen wurde eine weitere Experimentreihe<br />
durchgeführt, bei der die Potentialtiefe des optischen Gitters verändert wurde. Dies<br />
dient zum einen als zusätzliche Bestätigung des solitonischen Charakters der erzeugten<br />
Wellenpakete, zum anderen erhält man durch Vergleich mit numerischen Simulationen<br />
weitere Hinweise auf die Mechanismen, die zum beobachteten Teilchenzahlverlust führen.<br />
Bei ansonsten identischen Parametern wie bisher wurde die Potentialtiefe im Bereich<br />
zwischen 0.37 E r < U 0 < 0.92 E r variiert und die Evolutionszeit fest auf t = 40 ms eingestellt.<br />
Bei jeder Potentialhöhe wurden mehrere identische Experimente durchgeführt,<br />
von insgesamt ca. 100 Realisierungen führten etwa 50 zu <strong>Solitonen</strong>.