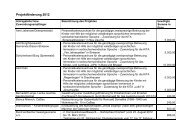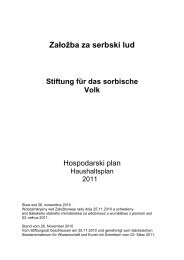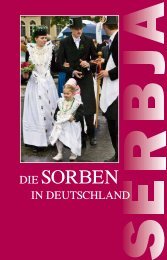3. Serbski dom Budyšin a Choćebuz - Stiftung für das sorbische Volk ...
3. Serbski dom Budyšin a Choćebuz - Stiftung für das sorbische Volk ...
3. Serbski dom Budyšin a Choćebuz - Stiftung für das sorbische Volk ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
48<br />
Teil II – Gesamtkonzept zur Förderung der <strong>sorbische</strong>n Sprache und Kultur<br />
Feinheit des Tschechischen herankommt<br />
und ihre Herkunft aus dem bäuerlichen<br />
Milieu nicht verleugnen kann. Insofern ist<br />
der 1848 ff. im Obersorbentum vollzogene<br />
Beschluß, sich bei der Standardisierung<br />
in manchem nach dem Tschechischen zu<br />
richten und die unterschiedlichen Sprachebenen<br />
nebeneinander bestehen zu lassen,<br />
von neuem bedenkenswert. Das jetzige<br />
phonetische und grammatische Bild des<br />
Sorbischen als Hybrid zwischen Deutsch<br />
und Slawischem ist problematischer, als es<br />
die derzeitige Diskussion um Schülbücher<br />
etc. vermuten läßt.<br />
Zwischen 1945 und 1948 besuchten rund<br />
700 Obersorben <strong>das</strong> tschechische Gymnasium<br />
in Varnsdorf. Vor dem Hintergrund<br />
der durch Jugoslawien vermittelten Bestrebungen<br />
der Sorben um einen Anschluß<br />
der Oberlausitz an die Tschechoslowakei<br />
ist unschwer zu erkennen, daß<br />
den deutschen Machthabern in der SBZ<br />
wie der staatlich geförderte Aufbau einer<br />
fünften Kolonne erscheinen mußte. Der<br />
Aufbau umfassender Bildungs- und Kulturförderungsstrukturen<br />
sowie die beiden<br />
Landesgesetze Brandenburg und Sachsen<br />
1948 ist von daher stets auch als Unterbindung<br />
einer solchen staatenübergreifenden<br />
Fraternisierung zu lesen – die <strong>sorbische</strong>n<br />
Institutionen sind der Preis <strong>für</strong> die<br />
Mitwirkung am sozialistischen Menschenbild,<br />
aber auch <strong>für</strong> den Verzicht auf panslawische<br />
Annäherung.<br />
Heute, mit dem auf allen vier Seiten<br />
der sächsisch-brandenburgisch-polnischtschechischen<br />
Grenzen verfassungsrechtlich<br />
geschützten Annäherungsgeboten<br />
wäre es sinnvoll und unschwer zu verwirklichen,<br />
an die Varnsdorfer Erfahrungen<br />
wiederanzuknüpfen. Hierbei bietet sich<br />
einerseits die alte Hauptstadt der beiden<br />
Lausitzen, Prag, als Ort an. Andererseits<br />
gibt es im östlichen Schlesien mit seinem<br />
autochthonen Dialekt des Schlesischen<br />
eine ihrerseits wiederum multilinguale<br />
Möglichkeit des Sprachenerwerbs. In den<br />
Gastfamilien und auf dem Pausenhof wird<br />
Schlesisch gesprochen, <strong>das</strong> auf der Grundlage<br />
des Polnischen gleichwohl eine hohe<br />
Affinität mit dem Tschechischen aufweist;<br />
in den Schulen wird Hochpolnisch unterrichtet<br />
(An die Nichtlinguisten sei hinzugefügt,<br />
daß man nur nicht glauben möge,<br />
daß wer Schulfranzösisch viele Jahre gebüffelt<br />
hat, auch nur ein Wort des Argot<br />
auf dem Pausenhof oder gar der gebildeten<br />
Zirkel verstehen würde. Die Differenz<br />
zwischen Umgangssprache und Standardsprache<br />
ist überall enorm). Daher würde<br />
sich parallel zu Prag die Partnerschaft mit<br />
Nysa (wo Eichendorff begraben liegt) und<br />
dem Raum Kattowitz fast stärker anbieten<br />
als der Raum Breslau mit seinen Zuwanderern<br />
aus Ost- und Zentralpolen.<br />
Mit einem Blick auf die besondere Benachteiligung<br />
der Mittel- und Hauptschüler<br />
in den EU-Regularien zum Auslandsspracherwerb<br />
(Hintergrund ist die in die<br />
romanischen, angelsächsischen und nordischen<br />
Länder nicht vermittelbare Dualität<br />
der deutschen, schweizerischen und österreichischen<br />
Berufsausbildung) sollte dabei<br />
ein besonderer Augenmerk auf der Vermittlung<br />
von <strong>sorbische</strong>n Mittelschülern<br />
bzw. Lehrlingen liegen.<br />
Prämisse 16: Verantwortung des Bundes<br />
Zwanzig Jahre nach dem Mauerfall und 19<br />
Jahre nach dem Abschluß von 2+4-<br />
Vertrag und Einigungsvertrag, die zusammen<br />
Deutschland eine ganz neue Stellung<br />
in der Welt verschafften, wird es Zeit,<br />
daß die Bundesrepublik Deutschland sich<br />
auch auf Bundesebene zu ihrer Verantwortung<br />
<strong>für</strong> die <strong>Volk</strong>sgruppe der Sorben<br />
ebenso bekennt wie dies die beiden Länder<br />
seit ihrer Neugründung in ihren Ge-