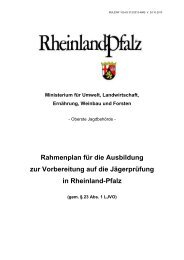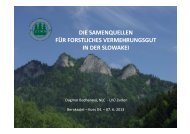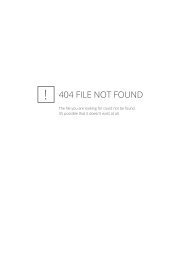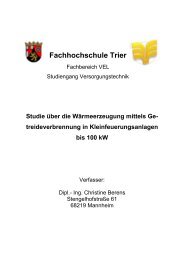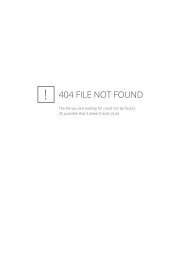Zentralstelle der Forstverwaltung - Landesforsten Rheinland-Pfalz
Zentralstelle der Forstverwaltung - Landesforsten Rheinland-Pfalz
Zentralstelle der Forstverwaltung - Landesforsten Rheinland-Pfalz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
saarländischen bergbaugebiet ausgehen. bze-<br />
Plots mit hohen geogenen Quecksilbergehalten<br />
kommen vereinzelt auch in den tonschiefern von<br />
hunsrück und eifel vor.<br />
im südwestlich anschließenden Saarländisch-<br />
Pfälzischen Muschelkalkgebiet fällt nur ein<br />
bze-Punkt bei Mittelbach mit erhöhten schwermetallgehalten<br />
auf. es handelt sich hierbei um<br />
einen Kalkverwitterungslehm; die schwermetallgehalte<br />
entsprechen dem typ G. die hohen<br />
schwermetallgehalte beruhen hier auf <strong>der</strong><br />
anreicherung im Residualton im Rahmen <strong>der</strong><br />
Kalksteinverwitterung.<br />
5.7.9.4 fazit<br />
die in <strong>der</strong> bze ii festgestellten Verteilungsmuster<br />
erhöhter schwermetallgehalte beruhen<br />
auf <strong>der</strong> Überlagerung mehrerer Quellen. Viele<br />
rheinland-pfälzische ausgangssubstrate weisen<br />
bereits primär vergleichsweise hohe schwermetallgehalte<br />
auf. dazu kommt eine über zwei<br />
Jahrtausende ausgeübte bergbautätigkeit, bei<br />
<strong>der</strong> in überwiegend kleineren Gruben Gangerze -<br />
eisen-Manganerze, blei-zinkerze, Kupfererze und<br />
Quecksilbererze - fast flächendeckend über die<br />
meisten naturräume abgebaut und meist auch<br />
lokal verhüttet wurden. neben stäuben und abschwemmungen<br />
aus den halden, waren wohl die<br />
hütten die hauptquelle für diffuse einträge in die<br />
umliegenden oberböden. die jüngeren diffusen<br />
einträge z.b. blei aus verbleitem benzin erhöhten<br />
diese belastung. an einigen wenigen bze-Plots<br />
fanden sich auch hinweise auf lokale industrielle<br />
Quellen.<br />
5.8 Regenerationsfähigkeit <strong>der</strong> Waldböden<br />
die in Kapitel 5.3 dargestellten befunde zur<br />
bodenversauerung belegen, dass viele Waldböden<br />
nur unzureichend in <strong>der</strong> lage sind, im Ökosystem<br />
intern freigesetzte o<strong>der</strong> extern zugeführte säuren<br />
zu puffern. auch wenn sich die situation seit <strong>der</strong><br />
ersten bodenzustandserhebung merklich verbessert<br />
hat, weisen doch viele Ökosysteme noch geringe<br />
Vorräte pflanzenverfügbarer nährstoffkationen<br />
auf (vgl. Kap. 5.4). zudem zeigen die befunde<br />
des wässrigen extrakts in vielen standorten noch<br />
hohe Gehalte mobiler anionen (nitrat, sulfat),<br />
<strong>der</strong>en auswaschung über den sickerwasseraus-<br />
trag hohe Kationenverluste als ladungsausgleich<br />
verursachen wird (vgl. Kap. 5.5.3).<br />
Viele Waldböden zeigen demnach noch sehr<br />
deutlich die folgen geschichtlicher Übernutzung<br />
und überhöhter luftschadstoffeinträge und sind<br />
in ihren Puffer- und filterfunktionen sowie in<br />
ihrer speicherfunktion für nährstoffe erheblich<br />
eingeschränkt.<br />
die Regenerationsfähigkeit dieser böden hängt<br />
im Wesentlichen von ihrer fähigkeit ab, das speichervermögen<br />
und insbeson<strong>der</strong>e die speicherung<br />
basischer Kationen über positive ökosystemare<br />
stoffbilanzen langfristig wie<strong>der</strong> auf ein standortangepasstes<br />
niveau anzuheben. eine schlüsselrolle<br />
spielt hierbei die als „nachschaffende<br />
Kraft“ bezeichnete freisetzung von basekationen<br />
bei <strong>der</strong> Mineralverwitterung.<br />
erste hinweise auf das dementsprechende standortspotenzial<br />
lassen sich aus den säureextrahierbaren<br />
nährstoffvorräten im boden herleiten. eine<br />
differenziertere einwertung liefern Mineralanalysen<br />
sowie eine Modellierung <strong>der</strong> Mineralverwitterung<br />
mit PRofile.<br />
5.8.1 Säureextrahierbare Nährstoffvorräte<br />
bei <strong>der</strong> bze ii wurden die Vorräte <strong>der</strong> im Königswasser<br />
extrahierten nährstoffe für den effektiven<br />
Wurzelraum (humusauflage und Mineralboden<br />
bis Wurzeltiefe) bestimmt. diese Vorräte können<br />
als mittel- bis langfristig freisetzbare nährstoffreserven<br />
angesehen werden (aK standortskartierung<br />
2003, Kap. b.3.4.4.2.4). die bewertung <strong>der</strong><br />
daten folgt einem Vorschlag des arbeitskreises<br />
standortskartierung (2003, tab. 75) mit einer<br />
stufeneinteilung als Vielfaches (50, 100, 200,<br />
500 Jahre) einer angenommenen jährlichen Verwitterungsrate<br />
von 1 kmol/ha bei K, Ca, Mg.<br />
die säureextrahierbaren Calciumvorräte im<br />
Wurzelraum variieren zwischen 0,3 und 1231 t/<br />
ha mit einem Median von 2,6 t/ha. zwei drittel<br />
<strong>der</strong> Rasterpunkte sind den bewertungsgruppen<br />
„sehr gering“ und „gering“ zuzuordnen (abb. 70).<br />
nur etwas weniger als ein fünftel <strong>der</strong> untersuchten<br />
standorte entfallen in die Gruppen „hoch“<br />
und „sehr hoch“. sehr hohe Calciumvorräte (><br />
100 t/ha) weisen erwartungsgemäß vor allem<br />
Carbonatstandorte, Kalkverwitterungslehme und<br />
133