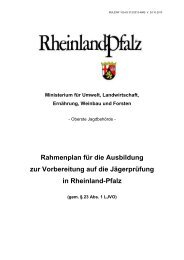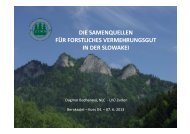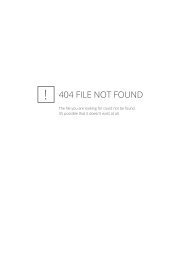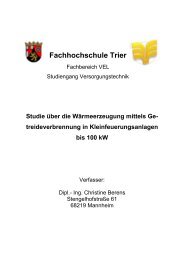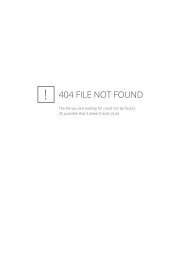Zentralstelle der Forstverwaltung - Landesforsten Rheinland-Pfalz
Zentralstelle der Forstverwaltung - Landesforsten Rheinland-Pfalz
Zentralstelle der Forstverwaltung - Landesforsten Rheinland-Pfalz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
signifikante abnahme <strong>der</strong> basensättigung vom<br />
feinboden zum skelett, während die Proben mit<br />
höherer basensättigung gleiche o<strong>der</strong> etwas höhere<br />
basensättigungen im skelett aufweisen. denkbar<br />
ist, dass dieser befund mit <strong>der</strong> „Waschung“<br />
des feinskeletts vor <strong>der</strong> analyse zusammenhängt.<br />
Während bei <strong>der</strong> ermittlung <strong>der</strong> austauschbaren<br />
Kationen im feinboden <strong>der</strong> wasserlösliche ionenpool<br />
miterfasst wird, geht dieser teil <strong>der</strong> ionen<br />
bei <strong>der</strong> Reinigung des skeletts vor <strong>der</strong> analyse<br />
verloren. insbeson<strong>der</strong>e bei sehr armen substraten<br />
dürfte dem wasserlöslichen ionenpool aber ein<br />
relativ höherer beitrag zukommen als bei reicheren<br />
standorten. Möglicherweise wird somit durch<br />
die Probenvorbehandlung des skeletts trotz <strong>der</strong><br />
berücksichtigung <strong>der</strong> „ummantelung“ gerade auf<br />
den beson<strong>der</strong>s armen standorten die nährstoffverfügbarkeit<br />
im bodenskelett unterschätzt.<br />
bei berücksichtigung <strong>der</strong> gröberen skelettfraktion<br />
bis 63 mm durchmesser nehmen die austauschbaren<br />
Kationengehalte als effekt <strong>der</strong> geringeren<br />
oberfläche weiter ab. im Mittel (Median) erreichen<br />
die Gehalte im Gesamtskelett bis 63 mm für<br />
Magnesium und Mangan ein fünftel, Kalium und<br />
aluminium ein sechstel, Calcium ein achtel und<br />
eisen weniger als ein zehntel <strong>der</strong> entsprechenden<br />
Kationenkonzentrationen im feinboden.<br />
die im skelett insgesamt (skelett 2 – 63 mm einschließlich<br />
„ummantelung“) im Mineralboden bis<br />
90 cm tiefe (bei flachgründigen standorten bis<br />
beprobungstiefe) vorhandenen elementvorräte<br />
zeigen eine sehr große spanne.<br />
die Calciumvorräte im skelett variieren zwischen<br />
0,5 und 12.064 kg/ha mit einem Median von 29<br />
kg Ca/ha. auch <strong>der</strong> anteil des im skelett verfügbaren<br />
Vorrats am Gesamtvorrat (feinboden<br />
+ skelett) unterscheidet sich von Plot zu Plot<br />
beträchtlich. er variiert beim Calcium zwischen<br />
0,2 % und 73 %.<br />
die Magnesiumvorräte im skelett liegen zwischen<br />
0,05 und 2.218 kg/ha mit einem Median von 15<br />
kg Mg/ha. auch beim Magnesium variieren die<br />
anteile des Vorrats im skelett am Gesamtvorrat<br />
in einem sehr weiten Rahmen (0,1 bis 75 %).<br />
die Kaliumvorräte im skelett weisen eine spanne<br />
von 0,4 bis 943 kg/ha mit einem Median von 29<br />
kg K/ha auf. die anteile des in skelett verfügbaren<br />
Vorrats am Gesamtvorrat variieren zwischen 0,2<br />
und 59 %.<br />
für die analyse <strong>der</strong> skelettfraktion wurden gezielt<br />
diejenigen Plots ausgewählt, die aufgrund ihres<br />
(hohen) skelettgehalts und ihrer ausgangsgesteine<br />
vergleichsweise höhere Vorräte austauschbarer<br />
Kationen im bodenskelett erwarten ließen.<br />
daher ist anzunehmen, dass bei den übrigen 88<br />
nicht untersuchten Profilen des bze ii-Kollektivs<br />
das bodenskelett nur in vergleichsweise geringem<br />
umfang zum Gesamtvorrat <strong>der</strong> jeweiligen Kationen<br />
beiträgt.<br />
unter <strong>der</strong> annahme, dass bei den nicht untersuchten<br />
standorten <strong>der</strong> anteil des skeletts am<br />
Gesamtvorrat unter 10 % liegt, weisen bei den<br />
basekationen drei Viertel bis vier fünftel <strong>der</strong><br />
standorte <strong>der</strong> bze ii im skelett verfügbare anteile<br />
von weniger als 10 % am Gesamtvorrat auf (tabelle<br />
8). Vergleichsweise hohe anteile (> 30 %)<br />
wurden für meist deutlich weniger als 10 % des<br />
Kollektivs kalkuliert.<br />
5.5 Status und Verän<strong>der</strong>ung von Stickstoff<br />
in den Waldökosystemen<br />
stickstoff (n) ist das in den Waldökosystemen<br />
bedeutsamste nährelement. Mit ausnahme von<br />
auenwäl<strong>der</strong>n, bestimmten edellaubholzwäl<strong>der</strong>n<br />
und erlenbrüchen ist die biomasseproduktion in<br />
Waldökosystemen von natur aus meist stickstofflimitiert.<br />
durch eine Jahrhun<strong>der</strong>te andauernde<br />
Übernutzung bis in das 20. Jahrhun<strong>der</strong>t hinein<br />
wurde <strong>der</strong> stickstoffspeicher <strong>der</strong> Ökosysteme<br />
erheblich entleert und die stickstoffknappheit<br />
verschärft. erst in <strong>der</strong> zweiten hälfte des 20.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts verän<strong>der</strong>te sich diese situation zum<br />
einen durch die Reduzierung des biomasseexports<br />
im zuge einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung<br />
und zum an<strong>der</strong>en durch hohe stickstoffeinträge<br />
infolge <strong>der</strong> emission von stickoxiden aus dem<br />
zunehmenden straßenverkehr und <strong>der</strong> ammoniakemission<br />
aus einer intensivierten Viehhaltung<br />
(vgl. block 2006). trotz vermehrter anstrengungen<br />
zur luftreinhaltung sind die stickstoffeinträge<br />
in die Waldökosysteme bislang nur wenig gesunken<br />
(block 2006; aktuelle depositionsraten in<br />
87