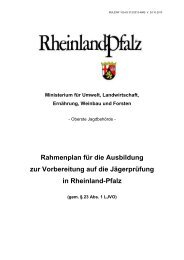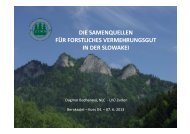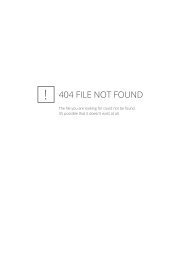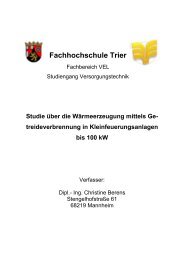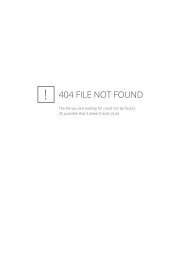Zentralstelle der Forstverwaltung - Landesforsten Rheinland-Pfalz
Zentralstelle der Forstverwaltung - Landesforsten Rheinland-Pfalz
Zentralstelle der Forstverwaltung - Landesforsten Rheinland-Pfalz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
potenzial und eine hohe Kaliumnachlieferung<br />
gekennzeichnet. Mit ausnahme eines flachgründigen<br />
standortes sind die säurelöslichen<br />
Magnesiumvorräte <strong>der</strong> standorte dieser Klasse<br />
sehr hoch. die Caliciumvorräte variierten demgegenüber<br />
zwischen sehr gering und hoch. bei den<br />
feldspatreichen substraten ist demnach von einer<br />
meist hohen Mg-freisetzung und einer variablen<br />
Calciumfreisetzung auszugehen.<br />
9 <strong>der</strong> 165 Rasterpunkte waren nach den vorgegebenen<br />
Kriterien nicht den vorstehend beschriebenen<br />
substratklassen 1 bis 10 zuzuordnen und<br />
fielen daher in die Klasse 11 –übrige substrate-.<br />
Meist handelt es sich hierbei um Mischsubstrate,<br />
z.b. Kolluvien. die böden dieser sammelgruppe<br />
weisen meist eher bessere Verhältnisse auf: die<br />
säurelöslichen Vorräte an Magnesium und Kalium<br />
liegen mit ausnahme eines sehr flachgründigen<br />
und skelettreichen standorts in den bewertungsstufen<br />
„hoch“ bis „sehr hoch“. die Calciumvorräte<br />
sind sehr variabel und reichen von sehr gering bis<br />
hoch.<br />
5.8.3 Nährelementnachlieferung durch<br />
Mineralverwitterung<br />
die nachlieferung <strong>der</strong> nährelemente Kalium,<br />
Calcium und Magnesium wurde mit hilfe von<br />
PRofile (sverdrup und Warfvinge 1995) kalkuliert.<br />
in die PRofile-simulation flossen daten<br />
<strong>der</strong> Wasserhaushaltsmodellierung mit lWf/<br />
bRooK 90 (schulze und scherzer 2011) und<br />
depositionsmodellierung von Gauger (2010)<br />
für jeden bze ii-Rasterpunkt ein. die Parametrisierung<br />
im hinblick auf die Mineralausstattung<br />
erfolgte durch butz-braun (2010). die Kalkulation<br />
<strong>der</strong> Mineralverwitterung wurde jeweils für<br />
die einzelnen bodenhorizonte bis zur effektiven<br />
Wurzeltiefe durchgeführt. für tiefenbereiche, für<br />
die keine Mineralanalysen vorlagen, wurde die<br />
Mineralzusammensetzung aus den darüber- und<br />
darunterliegenden analysierten horizonten unter<br />
berücksichtigung <strong>der</strong> zugehörigkeit zur jeweiligen<br />
stratigraphischen lage geschätzt.<br />
die kalkulierten freisetzungsraten variieren in<br />
einem sehr weiten Rahmen (Ca: 0,02 - 3551 kg/<br />
ha*Jahr, Median 0,8; Mg: 0,02 - 361 kg/ha*Jahr,<br />
Median 2,1; K: 0,1 - 170 kg/ha*Jahr, Median 5,6).<br />
Ca- und Mg-freisetzungsraten von jeweils mehr<br />
als 100 kg/ha*Jahr wurden erwartungsgemäß für<br />
die carbonat- (und dolomit-)haltigen substrate,<br />
freisetzungsraten von über 10 kg für die Pyri-bolhaltigen<br />
substrate und einige <strong>der</strong> smektit- und<br />
chlorithaltigen sowie <strong>der</strong> illitreichen substrate ermittelt.<br />
Kaliumfreisetzungsraten von über 10 kg/<br />
ha*Jahr zeigen sich vor allem auf den illitreichen<br />
sowie den carbonathaltigen und den smektit- und<br />
chlorithaltigen substraten. erwartungsgemäß<br />
sind die freisetzungsraten an allen drei nährstoffen<br />
bei quarzreichen substraten sowie den meist<br />
ebenfalls quarzreichen, amorphe al-hydroxyde<br />
enthaltenen substraten nur sehr gering. entsprechend<br />
häufen sich Rasterpunkte mit geringer<br />
nährstoffnachlieferung aus <strong>der</strong> Mineralverwitterung<br />
vor allem im Pfälzerwald (Karten 40, 41, 42).<br />
demgegenüber weisen die Plots im Westerwald<br />
meist vergleichsweise hohe freisetzungsraten auf.<br />
für die Mineralverwitterung spielen nicht nur<br />
die Mineralgehalte son<strong>der</strong>n auch die reaktiven<br />
oberflächen eine große Rolle. demzufolge ergeben<br />
sich auf beson<strong>der</strong>s skelettreichen und/o<strong>der</strong><br />
sandigen substraten auch bei Vorkommen von<br />
Mineralen mit vergleichsweise hohen nährelementgehalten<br />
und guter Verwitterbarkeit häufig<br />
nur geringe freisetzungsraten. auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
seite können standorte mit quarzreichen substraten<br />
bei wurzelerreichbaren „besseren“ schichten<br />
im unterboden im einzelfall auch vergleichsweise<br />
hohe freisetzungsraten zeigen.<br />
auffällig sind die im Gesamtkollektiv mit ausnahme<br />
<strong>der</strong> wenigen Carbonat- o<strong>der</strong> Pyri-bol-haltigen<br />
substrate nur sehr geringen Calciumfreisetzungsraten.<br />
selbst im „relativ mittleren bereich“<br />
(vgl. Karte 40) trägt die Ca-freisetzung aus <strong>der</strong><br />
Mineralverwitterung nur wenig zur nährstoffversorgung<br />
des Ökosystems bei. an mehr als<br />
drei Vierteln <strong>der</strong> Plots dürfte <strong>der</strong> bedarf für das<br />
aufwachsen <strong>der</strong> Waldbestände aus <strong>der</strong> Mineralverwitterung<br />
allein nicht zu decken sein. auch<br />
reichen die freisetzungsraten hier nicht aus, den<br />
entzug mit <strong>der</strong> holzernte von 2 – 8 kg Ca/ha*Jahr<br />
je nach bestockung, standort und ernteintensität<br />
auszugleichen. demgegenüber liegen bei Magnesium<br />
und Kalium die kalkulierten freisetzungsraten<br />
an <strong>der</strong> Mehrzahl <strong>der</strong> standorte oberhalb<br />
<strong>der</strong> spannen <strong>der</strong> mittleren entzüge durch die<br />
holzernte (0,4 – 1,3 kg Mg/ha*Jahr; 1,1 – 4,5 kg<br />
K/ha*Jahr; (block et al. 2008, hagemann et al.<br />
2008, Rademacher et al. 1999, Rademacher et al.<br />
2001, Raspe und Göttlein 2008).<br />
145